Polen
Rzeczpospolita Polska Republik Polen | |||||
| |||||
Amtssprache | Polnisch | ||||
Hauptstadt | Warschau | ||||
Staatsform | parlamentarische Republik | ||||
Regierungssystem | parlamentarische Demokratie | ||||
Staatsoberhaupt | Staatspräsident Andrzej Duda | ||||
Regierungschef | Ministerpräsident Mateusz Morawiecki | ||||
Fläche | 312.679 km² | ||||
Einwohnerzahl | 38.427.000 (2016)[1] | ||||
Bevölkerungsdichte | 123 Einwohner pro km² | ||||
Bevölkerungsentwicklung | ▲ 0,0384 %[2] pro Jahr | ||||
Bruttoinlandsprodukt
| 2017[3]
| ||||
Index der menschlichen Entwicklung | ▲ 0,865 (33.) (2017)[4] | ||||
Währung | Złoty (PLN) | ||||
Gründung | 960–992 n. Chr. | ||||
Unabhängigkeit | 11. November 1918 | ||||
Nationalhymne | Mazurek Dąbrowskiego | ||||
Zeitzone | UTC+1 MEZ UTC+2 MESZ (März bis Oktober) | ||||
Kfz-Kennzeichen | PL | ||||
ISO 3166 | PL, POL, 616 | ||||
Internet-TLD | .pl | ||||
Telefonvorwahl | +48 | ||||
  | |||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||
Karte Polens mit den Hauptstädten der Woiwodschaften. Markiert sind daneben die wichtigsten Küstengewässer, der größte See und der höchste Berg. |
Polen (polnisch Polska .mw-parser-output .IPA a{text-decoration:none}[ˈpɔlska] , amtlich Rzeczpospolita Polska, , deutsch Republik Polen) ist eine parlamentarische Republik in Mitteleuropa. Hauptstadt und zugleich größte Stadt des Landes ist Warschau (polnisch Warszawa), größter Ballungsraum die Metropolregion um Katowice. Polen ist ein in 16 Woiwodschaften gegliederter Einheitsstaat. Mit einer Größe von 312.679 Quadratkilometern ist Polen das sechstgrößte Land der Europäischen Union und mit 38,5 Millionen Einwohnern ebenfalls das sechstbevölkerungsreichste. Es herrscht vorwiegend das ozeanische Klima im Norden und Westen sowie das kontinentale Klima im Süden und Osten des Landes.
Im frühen Mittelalter siedelten sich im Zuge der Völkerwanderung Stämme der westlichen Polanen in Teilen des heutigen Staatsgebietes an. Eine erste urkundliche Erwähnung fand im Jahr 966 unter dem ersten historisch bezeugten polnischen Herzog Mieszko I. statt, welcher das Land dem Christentum öffnete. 1025 wurde das Königreich Polen gegründet, bis es sich 1569 durch die Union von Lublin mit dem Großherzogtum Litauen zur Königlichen Republik Polen-Litauen vereinigte und zu einem der größten und einflussreichsten Staaten in Europa wurde.[5] In dieser Zeit entstand 1791 die erste moderne Verfassung Europas.
Durch die drei Teilungen Polens Ende des 18. Jahrhunderts von den Nachbarstaaten seiner Souveränität beraubt, erlangte Polen mit dem Vertrag von Versailles seine Unabhängigkeit 1918 zurück. Der Einmarsch des Deutschen Reiches und der Sowjetunion am Beginn des Zweiten Weltkrieges und deren Besatzungsherrschaft kostete Millionen polnischer Bürger, insbesondere polnische Juden, das Leben. Seit 1952 als Volksrepublik Polen unter sowjetischem Einfluss stehend, erlebte das Land 1989, insbesondere in Folge des Einflusses der Solidarność-Bewegung, einen politischen und wirtschaftlichen Systemwechsel. Seit 2004 ist Polen Mitglied der Europäischen Union und eine starke Wirtschaftskraft in Mitteleuropa.
Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist Polen das zweiundzwanzigstreichste Land der Erde mit der einundzwanzigsthöchsten Kaufkraftparität. Im Index der menschlichen Entwicklung erreicht Polen einen hohen Wert (2017: Rang 33 mit Indexwert 0,865). Zwischen west- und osteuropäischen Kulturräumen gelegen und durch eine wechselhafte Geschichte geprägt, entwickelte das Land ein reiches kulturelles Erbe. Einige seiner Bürger lieferten wichtige Beiträge in den Natur- und Sozialwissenschaften, der Mathematik, der Literatur, dem Film und der Musik. Polen ist Mitglied der Vereinten Nationen, der OSZE, der NATO, des Europarates und der Europäischen Union.
Inhaltsverzeichnis
1 Landesname
2 Geographie
2.1 Relief
2.2 Geologie
2.3 Flüsse
2.4 Seen
2.5 Küste
2.6 Gebirge
2.7 Flora
2.8 Fauna
2.9 Bodennutzung
2.10 Naturschutz
2.11 Klima
3 Bevölkerung
3.1 Demographische Struktur
3.2 Ethnien
3.3 Sprachen
3.4 Religionen
4 Geschichte
4.1 Urgeschichte
4.2 Piasten
4.3 Jagiellonen
4.4 Adelsrepublik
4.5 Teilungen
4.6 Erster Weltkrieg
4.7 Zweite Republik
4.8 Zweiter Weltkrieg
4.9 Volksrepublik
4.10 Dritte Republik
5 Politik
5.1 Verfassung
5.2 Legislative
5.3 Exekutive
5.4 Judikative
5.5 Parteien
5.6 Außenpolitik
5.7 Militär
5.8 Verwaltung
5.9 Städte
6 Wirtschaft und Infrastruktur
6.1 Staatshaushalt
6.2 Steuern
6.3 Außenhandel
6.4 Arbeitsmarkt
6.5 Energieversorgung
6.6 Unternehmen
6.7 Tourismus
6.8 Verkehr
6.9 Bildung
6.10 Wissenschaft
7 Kultur
7.1 Literatur
7.2 Musik
7.3 Bildende Kunst
7.4 Architektur
7.5 Film
7.6 Medien
7.7 Bräuche
7.8 Küche
7.9 Freizeit
7.10 Sport
7.11 Feiertage
8 Siehe auch
9 Literatur
10 Weblinks
11 Einzelnachweise
Landesname

Denar Princes Polonie geschlagen um 1000 n. Chr.
Der vollständige Name Polens lautet Rzeczpospolita Polska, auf Deutsch Republik Polen. Der Begriff Rzeczpospolita nimmt dabei jedoch explizit Bezug auf die bis 1795 existierende Adelsrepublik und ist keine bloße Übersetzung des Begriffes Republik, auf Polnisch Republika. Im Gegensatz zu dessen lateinischer Bedeutung, Sache des Volkes oder öffentliche Sache, bedeutet der Begriff Rzeczpospolita wortwörtlich gemeinsame Sache. Der Begriff Rzeczpospolita ist allein der Republik Polen vorbehalten, andere Republiken werden im Polnischen schlicht als Republika bezeichnet.
Der Name Polen leitet sich wiederum vom westslawischen Stamm der Polanen (Polanie) ab, die sich im 5. Jahrhundert im Gebiet der heutigen Woiwodschaft Großpolen um Posen (Poznań) und Gnesen (Gniezno), zwischen den Flüssen Oder (Odra) und Weichsel (Wisła), niederließen. Die Polanen, deren Bezeichnung erst um das Jahr 1000 auftrat,[6] waren größtenteils Ackerbauern; ihr Name entwickelte sich demnach aus dem Wort pole, auf Deutsch Feld.[7]
In mehreren östlichen Sprachen geht der Name Polens nicht auf die Polanen, sondern auf den Südostpolnischen Volksstamm im Gebiet der heutigen Woiwodschaft Karpatenvorland um Przemyśl – der Lendizen (Lędzianie) – zurück, dessen Name wiederum von dem legendären polnischen Herrscher Lech, bekannt aus der Sage um Lech, Čech und Rus, stammt, so zum Beispiel im Lateinischen Lechia, im Persischen Lachistan, im Litauisch Lenkija und die Bezeichnung für Pole im Türkischen Lehce, im Russischen Lach und im Ungarischen Lengyel.
Geographie
 |  |
| Physische Karte | Lage Polens in Europa |
Polens Staatsgebiet bedeckt eine Fläche von 312.679 km²[8] und ist damit das neuntgrößte Land in Europa sowie das achte Land gemessen nach der Bevölkerungszahl. Weltweit belegt es entsprechend die Plätze 70 und 35. Zum Staatsgebiet Polens gehört auch im Festlandsockel das Küstenmeer sowie die Anschlusszone in der Ostsee.
Insgesamt hat Polen 3.583 Kilometer Staatsgrenze, 524 Kilometer davon in der Ostsee und auf 1.221 Kilometer verläuft die Grenze an Flüssen.[9] Insgesamt grenzt Polen an sieben Staaten und ist damit eines der Länder mit den meisten europäischen Nachbarn. Im Norden grenzt es an
- die Ostsee (440 km) und
Russland die russische Oblast Kaliningrad (Landgrenze 210 km und Seegrenze 22 km),
die russische Oblast Kaliningrad (Landgrenze 210 km und Seegrenze 22 km),
im Osten an
Litauen Litauen (104 km),
Litauen (104 km),
Weissrussland Weißrussland (418 km) und
Weißrussland (418 km) und
Ukraine die Ukraine (535 km),
die Ukraine (535 km),
im Süden an
Slowakei die Slowakei (541 km) und
die Slowakei (541 km) und
Tschechien Tschechien (796 km) und
Tschechien (796 km) und
im Westen an
Deutschland Deutschland (Landgrenze 467 km und Seegrenze 22 km).
Deutschland (Landgrenze 467 km und Seegrenze 22 km).
Nach 1945 wurden nur geringfügige Grenzkorrekturen vorgenommen. Nördlichster Punkt Polens ist das Kap Rozewie, südlichster der Gipfel des Opołonek in den Bieszczady. Die Entfernung zwischen den beiden Punkten beträgt 649 Kilometer. Der westlichste Punkt ist die Stadt Cedynia, das östliche Pendant ist das Knie des Bug in der Gemeinde Horodło, 689 Kilometer entfernt. Im Winter ist der Tag im Norden Polens um mehr als eine Stunde kürzer als im Süden, im Sommer ist entsprechend der Tag im Süden kürzer als im Norden. Am Tag der Tagundnachtgleiche geht die Sonne in Ostpolen um ca. 40 Minuten früher auf und unter als im Westen. Polen liegt in der Mitteleuropäischen Zeitzone, deren Mitte der Meridian 15°, der durch die westlichen Woiwodschaften Polens verläuft. Der Gradnetzmittelpunkt liegt bei Ozorków, der Schwerpunkt weicht geringfügig davon ab.[10] Der geographische Mittelpunkt wird mit Piątek in der Woiwodschaft Łódź angegeben.
Relief

Frisches Haff bei Frombork

Hochgebirge der Hohen Tatra – Die Täler Roztoka und Fünf-Polnische-Seen-Tal von Świstówka Roztocka
Das Gebiet Polens kann in sechs geographische Räume eingeteilt werden. Von Nord nach Süd sind dies: die Küstengebiete, die Rückenlandschaften, das Tiefland, die Hochländer, die Vorgebirge und die Gebirge.[11] Die Übergänge zwischen den einzelnen Gebieten sind dabei fließend und werden in der Literatur leicht abweichend abgegrenzt.
Die Küste verläuft im Norden Polens an der Ostsee. Die Küstenniederungen sind schmal und um das Stettiner und das Frische Haff zungenförmig ausgeweitet. Die Landschaften bestehen aus flachen, breiten Tälern und ausgedehnten Grundmoränenplatten. Vor allem sandige, lehmhaltige und Moorböden dominieren die Bodenarten.[12]
Die Rückenlandschaft ist während der Eiszeiten entstanden, was sich durch die Gestaltung durch End- und Grundmoränen zeigt. Davon setzt sich deutlich die Sanderfläche im südöstlichen Teil ab. Hier befinden sich die großen polnischen Seenplatten, die in der letzten Eiszeit gestaltet wurden.
Zu den zusammenhängenden Tieflandgebieten zählen die das Schlesische Tiefebene, die Nord- und Mittelmasowische Tiefebene sowie das Tiefland Südpodlachiens.[13] Sie sind teil der Mitteleuropäischen Tiefebene. Durch diese verlaufen die Urstromtäler der Weichsel, Warthe und Oder.
Die polnischen Hochländer können in drei Hauptteile unterschieden werden, das Schlesisch-Krakauer im Süden, das sich östlich daran anschließende Kleinpolnische und das Lubliner Hochland im Südosten.[14] Das Roztocze wird teilweise zu letzterem gerechnet und teilweise als eigentändiges Hochland angesehen.
Zu den Vorgebirgslandschaften zählen das Schlesische Tiefland und die Beckenlandschaft der Vorkarpaten.[15] Unterschieden wird hier das Ostrauer Becken, das Auschwitzer Becken, das Krakauer Tor und das Sandomirer Becken. Hierbei handelt es sich um nährstoffreiche Lößböden, die zu den besten Ackerflächen in Polen gehören.
Im Süden Polens befinden sich die polnischen Mittelgebirge, des Krakau-Tschenstochauer Jura im südlichen Zentralpolen, das Heiligkreuzgebirge östlich hiervon, die Beskiden und Pieninen im Süden, die Waldkarpaten und Bieszczady im Südosten und die Sudeten mit dem Isergebirge, Riesengebirge und dem Glatzer Hochland im Südwesten. Zwischen Sudeten und Karpaten liegt die Mährische Pforte.
Das einzige Gebirge mit Hochgebirgscharakter und gleichzeitig die höchste Erhebung des Landes ist die Tatra mit der Hohen Tatra und der Westtatra. Die Tatra ist ein geologisch sehr vielseitiges Hochgebirge. Alle der über 70 polnischen Zweitausender befinden sich hier.
Geologie

Granitfelsen in der Hohen Tatra, Mengsdorfer Spitzen über dem Meerauge

Kalkfelsen des Pieninen-Felsengürtel, der die Äußeren von den Inneren Karpaten trennt

Postglaziale Moränenlandschaft der Suwalszczyzna
Der tiefere Untergrund Polens wird von einem Mosaik verschiedener Krustensegmente unterschiedlicher Herkunft und Zusammensetzung aufgebaut. Zwar treten die älteren Bestandteile nur in den südlichen Randbereichen des Landes auf, weil große Flächen in Nord- und Zentralpolen von jungen Sedimenten bedeckt sind, durch Tiefbohrungen ist aber auch in diesen Bereichen der Aufbau des Untergrundes bekannt.
Grundgebirge
Nordöstlich einer Linie, die durch die Orte Ustka an der Ostsee und Lublin markiert wird, stehen im Untergrund Gesteine an, welche die südwestliche Fortsetzung des Kontinents Baltica bilden. Es sind hochmetamorphe Gneise und Granulite, die während der Svekofennidischen Orogenese vor 1,8 Milliarden Jahren letztmals deformiert wurden. Diese Gesteine wurden vor 1,5 Milliarden Jahren von Anorthositen und Rapakivi-Graniten intrudiert und unterlagen in der Folgezeit einer langsamen Abtragung. Ab dem Kambrium war dieser alte Kraton, der Baltische Schild, von einem Flachmeer bedeckt, dessen geringmächtige Ablagerungen sich bis ins Silur nachweisen lassen.
Südwestlich an den Baltischen Schild schließt sich die 100 bis 200 km breite Zone der Kaledoniden an. Die Grenzzone zwischen den Kaledoniden und dem Baltischen Schild, die Tornquistzone, lässt sich von Dänemark bis in die Dobrudscha verfolgen. Die Gesteine des kaledonischen Gebirgszuges entstanden am Nordrand Gondwanas und wurden von diesem am Ende des Kambriums als langgestreckter, schmaler Mikrokontinent mit dem Namen Avalonia abgespalten. Der als Tornquist-Ozean bezeichnete Meeresraum zwischen Avalonia und Baltica wurde bis zum Oberordovizium subduziert, wodurch es zur Kollision und Gebirgsbildung kam. Im nördlichen Heiligkreuzgebirge (Lysagoriden) findet man kaledonisch deformierte Schelfsedimente des Baltischen Schildes, wohingegen der südliche Teil (Kielciden) präkambrische Gesteine enthält, die ursprünglich Teile Gondwanas waren. Auch das Małopolska-Massiv im Südwesten des Heiligkreuzgebirges ist gondwanidischen Ursprungs, allerdings driftete es unabhängig von Avalonia nach Norden und gelangte erst im Rahmen von Seitenverschiebungen bei der jüngeren, variszischen Orogenese in seine heutige Position.
Die dritte große Baueinheit wird von den variszisch deformierten Sudeten gebildet. Im frühen Ordovizium löste sich eine weitere Gruppe von Mikrokontinenten vom Nordrand Gondwanas und driftete durch die Subduktion des Rheischen Ozeans auf Baltica zu. Diese Kleinkontinente, zu denen die Böhmische Masse und das Saxothuringikum gehören, kollidierten im Mittel- und Oberdevon mit dem Südrand Balticas. Dabei entstanden auf polnischem Gebiet die Westsudeten (auch Lugikum genannt) mit ihren hochgradig metamorphen Paragneis-Folgen, in die die Granite des Iser- und Riesengebirges eindrangen. Schon im Karbon wurden abgesunkene Teile des variszischen Gebirges von ausgedehnten, baumbestandenen Niedermooren eingenommen, die heute in den Flözen des Oberschlesischen Steinkohlereviers dokumentiert sind.
Das jüngste Gebirge ist im südlichen Polen in den Karpaten aufgeschlossen. Im Eozän hatte sich die Tethys geschlossen und die Adriatische Platte, ein Sporn Gondwanas, kollidierte mit dem Südrand Europas. Im polnischen Anteil der Karpaten wurden Sedimentgesteine des Mesozoikums und des Paläogens nach Norden auf das ältere Grundgebirge überschoben.
Deckgebirge
Im Perm begann im heutigen Zentralpolen eine kontinuierliche Absenkung des gefalteten Untergrundes, so dass dort bis zu 10 km mächtige Sedimentgesteinsschichten abgelagert wurden. Im Rotliegenden enthalten die Ablagerungen noch Gesteine vulkanischen Ursprungs, aber ab dem Zechstein herrschten marine Bedingungen vor; in abgeschnürten Lagunen kam es auch zur Bildung von Steinsalz. Im Buntsandstein zog sich das Meer zurück und es wurden bis zu 1.400 m kontinentale Sande abgelagert. Danach wurde das Gebiet bis zum Ende des Mesozoikums vorwiegend von einem Flachmeer bedeckt, in dem Kalksteine und Tone zur Ablagerung kamen. Auch das ältere Grundgebirge (Heiligkreuzgebirge und Sudeten) war bis zum Ende der Kreide von diesen jungen Sedimenten bedeckt. Erst im frühen Paläogen vor etwa 55 Millionen Jahren kam es zu einer Heraushebung der alten Gebirgsmassive. In Zentralpolen wurden während des Paläogens und Neogens wurden nur etwa 250 m Sande und Tone abgelagert. Weite Bereiche des polnischen Tieflandes liegen unter einer nahezu geschlossenen Decke von Moränenmaterial sowie Kiesen und Sanden, die von den Gletschern der letzten Eiszeit aus Skandinavien herantransportiert wurden.
Flüsse

Die Weichsel in Warschau
Die längsten Flüsse sind die Weichsel (Wisła) mit 1022 km, der Grenzfluss Oder (Odra) mit 840 km, die Warthe (Warta) mit 795 km und der Bug mit 774 km.[8] Der Bug verläuft entlang der polnischen Ostgrenze. Die Weichsel und die Oder münden, wie zahlreiche kleinere Flüsse in Pommern, in die Ostsee. Die beiden Flüsse bestimmen das hydrographisch-fluviatile Gefüge Polens.[16] Die Alle (Łyna) und die Angrapa (Węgorapa) fließen über den Pregel und die Hańcza über die Memel in die Ostsee. Daneben entwässern einige kleinere Flüsse, wie die Iser in den Sudeten, über die Elbe in die Nordsee. Die Arwa aus den Beskiden fließt über die Waag und die Donau (Dunaj), genauso wie einige kleinere Flüsse aus den Waldkarpaten, über den Dnister ins Schwarze Meer. Pro Jahr fließen 58,6 km² Wasser ab, davon 24,6 km² als Oberflächenabfluss.[17]
Die polnischen Flüsse wurden schon sehr früh zur Schifffahrt genutzt. Bereits die Wikinger befuhren während ihrer Raubzüge durch Europa mit ihren Langschiffen die Weichsel und die Oder. Im Mittelalter und der Neuzeit, als Polen-Litauen die Kornkammer Europas war, gewann die Verschiffung von Agrarprodukten auf der Weichsel in Richtung Danzig (Gdańsk) und weiter nach Westeuropa eine sehr große Bedeutung, wovon noch viele Renaissance- und Barockspeicher in den Städten entlang des Flusses zeugen.
Seen

Wigry-See in Podlachien
Polen gehört mit 9300 geschlossenen Gewässern, deren Fläche einen Hektar überschreitet,[18] zu den seenreichsten Ländern der Welt. In Europa weist nur Finnland mehr Seen pro km² als Polen auf. Die größten Seen mit über 100 km² Fläche sind Śniardwy (Spirdingsee) und Mamry (Mauersee) in Masuren sowie das Jezioro Łebsko (Lebasee) und das Jezioro Drawsko (Dratzigsee) in Pommern. Neben den Seenplatten im Norden (Masuren, Pommern, Kaschubei, Großpolen) gibt es auch eine hohe Anzahl an Bergseen in der Tatra, von denen das Morskie Oko der flächenmäßig größte ist. Der mit 113 m tiefste See ist der Hańcza-See in der Seenplatte von Wigry, östlich von Masuren in der Woiwodschaft Podlachien. Gefolgt wird er von dem Drawsko mit 83 m sowie dem Bergsee Wielki Staw Polski (dt. Großer Polnischer See) im „Tal der fünf polnischen Seen“ mit 79 m.[19]
Zu den ersten Seen, deren Ufer besiedelt wurden, gehören die der Großpolnischen Seenplatte. Die Pfahlbausiedlung von Biskupin, die von mehr als 1000 Menschen bewohnt wurde, gründeten bereits vor dem 7. Jahrhundert v. Chr. Angehörige der Lausitzer Kultur. Die Vorfahren der heutigen Polen, die Polanen, bauten ihre ersten Burgen auf Seeinseln (ostrów). Der legendäre Fürst Popiel soll im 8. Jahrhundert von Kruszwica am Goplo-See regiert haben. Der erste historisch belegte Herrscher Polens, Herzog Mieszko I., hatte seinen Palast auf einer Wartheinsel in Posen.
Küste

Dünen bei Łeba
Die polnische Ostseeküste ist 528 km lang und erstreckt sich von Świnoujście (Swinemünde) auf den Inseln Usedom und Wolin im Westen bis nach Krynica Morska auf der Frischen Nehrung (auch Weichselnehrung genannt) im Osten. Die polnische Küste ist zum großen Teil eine sandige Ausgleichsküste, die durch die stetige Bewegung des Sandes aufgrund der Strömung und des Windes von West nach Ost charakterisiert wird. Dadurch bilden sich viele Kliffe, Dünen und Nehrungen, die nach dem Auftreffen auf Land viele Binnengewässer schaffen, wie z. B. das Jezioro Łebsko im Slowinzischen Nationalpark bei Łeba. Die bekanntesten Nehrungen sind die Halbinsel Hel und die Frische Nehrung. Die größte polnische Ostseeinsel ist Wolin. Die größten Hafenstädte sind Gdynia (Gdingen), Danzig (Gdańsk), Stettin (Szczecin) und Świnoujście. Die bekanntesten Ostseebäder sind Świnoujście, Sopot (Zoppot), Międzyzdroje (Misdroy), Kołobrzeg (Kolberg), Łeba (Leba), Władysławowo (Großendorf) und Jurata.
Gebirge

Rysy ist der höchste Gipfel Polens

Gebirgslandschaft von Bieszczady
Die drei wichtigen Gebirgszüge Polens sind von West nach Ost die Sudeten, die Karpaten und das Heiligkreuzgebirge. Alle drei gliedern sich wiederum in kleinere Gebirge. Das Gebirge mit der höchsten Reliefenergie sind die Sudeten, gefolgt vom Heiligkreuzgebirge, beide mit Werten von teilweise über 600 m/km².[20]
Charakteristisch für die Sudeten sind sanfte, gleichmäßige Oberflächen in den Höhenlagen und schroffe Ausformungen in den Tallagen. Der höchste Teil der Sudeten ist das Riesengebirge. Der ursprünglich das Gebirge bedeckende Mischwald wurde von Fichtenwäldern verdrängt.[21] Ab 1250 Metern beginnt die Krummholzzone.[22] Das Riesengebirge ist mit der Śnieżka (1602 m) der dritthöchste Gebirgszug in Polen.
Den Großteil der polnischen Karpaten nehmen die Beskiden ein, die mit 1725 m in der Babia Góra[8] das höchste Mittelgebirge in Mitteleuropa sind. Weitere Gebirgszüge der polnischen Karpaten sind die Gorce und Pieniny. Im Südosten Polens liegen die Waldkarpaten mit dem Gebirgszug der Bieszczady. In den äußeren Bereichen der Karpaten herrschen weiche Formen vor. In ihren inneren Regionen befindet sich ein alpiner Bereich mit Karen, Hörnern, Hang- und Trogtälern.[23]
Die Tatra an der polnisch-slowakischen Grenze[24] ist neben den Alpen das einzige Hochgebirge Mitteleuropas. Polen hat ca. 70 benannte Gipfel mit einer Höhe von über 2000 m. Sie befinden sich alle in der Hohen Tatra oder Westtatra. Mit 2499 m ist ein Nebengipfel des Rysy, nach dem Karsee Meerauge auch Meeraugspitze genannt, in der Hohen Tatra der höchste Berg Polens. Weitere bekannte Gipfel in der Hohen Tatra, an denen Polen Anteil hat, sind der Mięguszowiecki Szczyt Wielki (2438 m), der Niżnie Rysy (2430 m),der Mięguszowiecki Szczyt Czarny (2410 m) und der Mięguszowiecki Szczyt Pośredni (2393 m).
Depression
Bis 2013 galt der Ort Raczki Elbląskie in der Nähe von Elbląg im Weichseldelta in der Woiwodschaft Ermland-Masuren mit 1,8 m unter dem Meeresspiegel als am tiefsten gelegener Punkt Polens. Seit der Neuvermessung hält Marzęcino in der Nähe von Nowy Dwór Gdański in der Woiwodschaft Pommern diesen Rekord. Marzęcino liegt ebenfalls im Weichseldelta.
Flora

Białowieża Urwald
Polen ist eines der am meisten bewaldeten Länder Europas. Die polnischen Wälder nehmen eine Fläche von 9,1 Mio Hektar bzw. 29,2 % der Landesfläche ein und die Waldfläche nimmt durch Aufforstung ständig zu. Nach den Zielvorgaben soll die Waldfläche bis 2020 30 % und bis 2050 33 % der Landesfläche ausmachen. Im Osten Polens gibt es Urwälder, die nie von Menschen gerodet wurden, wie der Urwald von Białowieża. Große Waldgebiete gibt es auch in den Bergen, Masuren, Pommern und Niederschlesien. Das größte zusammenhänge Waldgebiet in Polen ist die Niederschlesische Heide. Zu den artenreichsten Biotopen gehören die Sümpfe der Biebrza, die 40 % der Fläche des Nationalparks Biebrza ausmachen.
Auf die Zusammensetzung der Pflanzenwelt in weiten Teilen Polens haben die letzten Eiszeiten einen großen Einfluss gehabt, insbesondere die Weichsel-Eiszeit. Nach dem Rückzug der Gletscher befand sich vor ca. 12 Tausend Jahren ein Tundragebiet in Nord- und Zentralpolen. Laubbäume wurden vor ca. 10 Tausend Jahren in Polen heimisch und das Gebiet wurde von einem dichten Mischwald bedeckt. Mit der folgenden Klimaerwärmung und der Ausbreitung des Menschen, hat sich die Pflanzenwelt in den folgenden Jahrtausenden stetig verändert. Die polnischen Mittelgebirge im Süden des Landes waren dagegen nicht von den Eismassen bedeckt. Die Pflanzenwelt hier war stets artenreicher, insbesondere auf den sonnigen und kalkhaltigen Böden der Pieninen. In Polen treten ca. 3.000 heimische Taxone, 67 Gefäßsporenpflanzen, 910 Moose, ca. 2.000 Chlorophyta und 39 Rotalgen auf.
Fauna

Wisent
Die Anzahl der Tier- und Pflanzenarten ist in Polen EU-weit am höchsten, ebenso die Anzahl der bedrohten Arten.[25] So leben hier etwa noch Tiere, die in Teilen Europas bereits ausgestorben sind, etwa der Wisent (Żubr) im Białowieża-Urwald und in Podlachien sowie der Braunbär in Białowieża, in der Tatra und in den Waldkarpaten, der Wolf und der Luchs in den verschiedenen Waldgebieten, der Elch in Nordpolen, der Biber in Masuren, Pommern und Podlachien. In den Wäldern trifft man auch auf Nieder- und Hochwild (Rotwild, Rehwild und Schwarzwild). Die Anzahl der heimischen Tierarten in Polen wird auf von 33 bis 47 Tausend geschätzt. Insgesamt leben in Polen über 90 Säugetier-, 444 Vogel-, neun Reptilien-, 18 Amphibien-, 119 Fisch-, fünf Kieferlose-, ca. 260 Weichtiere-, ca. 30 Tausend Insekten-, ca. ein und halb Tausend Spinnentiere-, ca. 240 Ringelwürmer- und ca. 4. Tausend Protozoenarten.
Polen ist das wichtigste Brutgebiet der europäischen Zugvögel. Rund ein Viertel aller Zugvögel, die im Sommer nach Europa kommen, brütet in Polen. Dies gilt insbesondere für die Seenplatten und die oftmals durch eigene Nationalparks geschützten Sumpfgebiete, u. a. die Gebiete des Nationalparks Biebrza (seit 1993), des Nationalparks Narew (seit 1996) und des Nationalparks Warthe (Warta, seit 2001). Auch der Tiefland-Urwald des Nationalparks Białowieża (seit 1932) ist ein großes Brutgebiet für Zugvögel.[26]
Bodennutzung
Die Waldfläche macht ca. 30 % der Landesfläche aus. Kiefern- und Buchenwälder dominieren in weiten Teil Polens.[27] Nordwestpolen wird dabei von Buchen dominiert, Richtung Nordosten treten verstärkt Fichten auf. In den Gebirgen Südpolens finden sich vor allem Eichenmisch- und Tannen-Buchenwälder.[27] Über die Hälfte der Fläche Polens wird landwirtschaftlich genutzt, wobei allerdings die Gesamtfläche der Äcker zurückgeht und gleichzeitig die verbliebenen intensiver bewirtschaftet werden. Die Viehzucht ist insbesondere in den Bergen weit verbreitet. Über ein Prozent der Fläche (3.145 km²) werden in 23 Nationalparks geschützt. In dieser Hinsicht nimmt Polen den ersten Platz in Europa ein. Drei weitere sollen in Masuren, im Krakau-Tschenstochauer Jura und in den Waldkarpaten neu geschaffen werden. Die meisten polnischen Nationalparks befinden sich im Süden des Landes. Zudem werden Sumpfgebiete an Flüssen und Seen in Zentralpolen geschützt sowie Küstengebiete im Norden. Hinzu kommen zahlreiche Reservate und Schutzgebiete.
Naturschutz
Mit 23 Nationalparks, die etwa ein Prozent der Landesfläche ausmachen, ist Polen eines der Länder in Europa mit den meisten Nationalparks. Der Tatra-Nationalpark ist mit über drei Millionen registrierten Eintritten pro Jahr der meistbesuchte Nationalpark in Polen. Der älteste und einer der bekanntesten Parks ist der 1923 gegründete Białowieża-Nationalpark an der Grenze zu Weißrussland.
Klima

Sonneneinstrahlung
Das Klima Polens ist ein gemäßigtes Übergangsklima. Hier trifft die trockene Luft aus dem eurasischen Kontinent mit der feuchten Luft des Atlantiks zusammen. Im Norden und Westen herrscht vor allem ein gemäßigtes Seeklima, im Osten und Südosten Kontinentalklima.[28] Als Trennlinie gilt die Achse zwischen oberer Warthe und unterer Weichsel.[29]
Von Juli bis September wehen die Winde meist aus westlicher Richtung, im Winter, besonders im Dezember und Januar, dominieren Winde aus Osten. Im Frühjahr und Herbst wechseln die Windrichtungen zwischen West und Ost. Die Windgeschwindigkeit liegt im Norden in der Regel zwischen 2 und 10 m/s, in den Bergen misst man auch Winde von über 30 m/s. In der Tatra treten Föhnwinde auf.[28]
An 120 bis 160 Tagen beträgt die Bewölkung über 80 Prozent, an 30 bis 50 Tagen ist die Bewölkung unter 20 Prozent.[28] Mit 1700 mm pro Jahr im mehrjährigen Mittel fallen in der Tatra die höchsten Niederschläge, die geringsten Niederschläge fallen mit unter 500 mm nördlich von Warschau, am Jezioro Gopło, westlich von Posen und bei Bydgoszcz. Weiter nördlich steigen die Niederschläge wieder auf 650 bis teilweise 750 mm.[30] Die niederschlagreichsten Monate sind der April und der September.[31] Im unteren Oder-Warthe-Gebiet fällt an etwa 30 Tagen Schnee, im Nordosten, den Karpaten und in den Beskiden sind es 100 bis 110 Tage. In den Gebirgen bleibt der Schnee 200 oder mehr Tage liegen.[31]
Die Jahresmitteltemperatur beträgt 5 bis 7 °C auf den Anhöhen der Pommerschen und Masurischen Seenplatte sowie auf den Hochebenen. In den Tälern des Karpatenvorlands, der Schlesischen und Großpolnischen Tiefebene beträgt sie 8 bis 10 °C. In den höheren Gebieten der Karpaten und Sudeten liegt die Temperatur bei 0 °C.[28]
Der wärmste Monat ist der Juli mit Mitteltemperaturen zwischen 16 und 19 °C. Dabei beträgt sie auf den Gipfeln von Tatra und Sudeten 9 °C, an der Küste 16 °C und in Zentralpolen 18 °C. Der kälteste Monat ist der Januar. Frost gibt es von November bis März. An der unteren Oder und der Küste an durchschnittlich 25 Tagen und bis zu 65 Tagen im Nordosten um Suwałki.[28]
Bevölkerung

Bevölkerungspyramide 2016
Demographische Struktur
Polen hat mit etwa 38 Millionen Einwohnern die achtgrößte Bevölkerungszahl in Europa und die sechstgrößte in der Europäischen Union. Die Bevölkerungsdichte beträgt 122 Einwohner pro Quadratkilometer. Die Geburtenrate betrug 2016 1,34 Kinder pro Frau.[32] Die Lebenserwartung betrug im Zeitraum von 2010 bis 2015 77,6 Jahre (Männer: 73,7, Frauen: 81,7).[33] Das Durchschnittsalter lag 2016 bei 40,3 Jahren und war im europäischen Vergleich relativ niedrig. Bis Mitte des Jahrhunderts droht Polen ein deutlicher Anstieg des Median-Alters und ein Absinken der Bevölkerung auf 33 Millionen Einwohner. Grund dafür sind die niedrige Geburtenrate und Auswanderung.[34] Die Geburtenzahl ist im Jahr 2017 wieder gestiegen und betrug zum ersten Mal seit mehreren Jahren mehr als 400 Tausend Lebendgeburten. Gleichzeitig sind seit dem Krieg im Donbas ca. 2 Mio Ukrainer nach Polen gezogen.
Ethnien

Polnisch-kaschubischer Wegweiser
Das heutige Polen ist seit dem Zweiten Weltkrieg ethnisch betrachtet ein äußerst homogener Staat, was ungewöhnlich in der polnischen Geschichte ist. Nach der Volkszählung von 2011 sind 99,7 % der Bevölkerung polnische Staatsbürger und 95,53 % davon bezeichnen sich ethnisch als Polen, wobei 2,17 % hiervon neben der polnischen Identität eine weitere angegeben haben.[35] Nach dem Zweiten Weltkrieg war es ein Ziel des kommunistischen Regimes, Homogenität unter anderem durch Zwangsumsiedlungen oder Assimilation der ethnischen Minderheiten zu erreichen. In der Verfassung von 1947 wurde Gleichheit der Bürger ohne Ansehen der Nationalität garantiert; jedoch wurden 1960 besondere Rechte für Minderheiten ermöglicht.[36] Seit 1997 ist der Schutz von Minderheiten in der Verfassung verankert.[37] Zu den nationalen Minderheiten gehören die Deutschen mit 0,28 % (0,068 %), Weißrussen mit 0,12 % (0,081 %), Ukrainer mit 0,12 % (0,068 %) und Russen mit 0,03 % (0,013 %) sowie Litauer, Tschechen, Slowaken und polnische Armenier. Zu den ethnischen Minderheiten gehören Kaschuben mit 0,59 % (0,042 %), Roma mit 0,04 % (0,023 %), Lemken mit 0,03 % (0,013 %) als auch Tataren, Karaim und Juden. Schlesier stellen 2,1 % (0,94 %) der polnischen Bevölkerung dar, wobei sie sich teilweise als Polen, teilweise als Deutsche, teilweise als Schlesier und teilweise als mehreren Gruppen gleichzeitig zugehörig bezeichnen.[35][38] Das Gesetz über die nationalen und ethnischen Minderheiten sowie über die Regionalsprache wurde 2005 erlassen. In diesem wird unter anderem geregelt, dass in Gemeinden, in denen mehr als 20 % der Einwohner einer Minderheit angehören, deren Sprache als Hilfssprache genutzt werden kann. Einzige anerkannte Regionalsprache ist Kaschubisch, dennoch sind in Gebieten mit einer deutschen Minderheit Hinweis- und Ortsschilder zweisprachig.[39] Unter den in den letzten Jahren zugewanderten ausländischen Staatsangehörigen stammen die meisten aus der Ukraine und Weißrussland. Auch Personen aus anderen Mitgliedsstaaten der EU, wozu vor allem Personen aus Deutschland, Italien, Frankreich und Bulgarien zählen, sind in den letzten Jahren nach Polen gezogen. Polen gehört zu den beliebtesten Zielländern für deutsche Auswanderer.[40] Weitere zahlenmäßig relevante Migrationsgruppen stammen aus Russland, aus dem Vietnam, der Volksrepublik China, der Türkei, Kasachstan und Nigeria.[41] Die Zahl der Auslandspolen weltweit wird auf bis zu 20 Millionen geschätzt. Die Anzahl der in Deutschland lebenden Polen beträgt ca. 1 Mio, wobei Doppelstaatler nicht hinzugerechnet werden.
Sprachen

Polnische Dialekte
Polnisch ist die Landessprache Polens und gehört der westslawischen Gruppe der indogermanischen Sprachen an.[42] In Polen verwendeten 1990 von den 38 Millionen Einwohnern etwa 37 Millionen Polnisch als Sprache im Alltag.[42] Etwa 8 Millionen Menschen außerhalb des polnischen Staatsgebietes nutzten Polnisch innerhalb der Familie.[42] Nach Russisch ist Polnisch die weltweit am häufigsten gesprochene slawische Sprache. Die Polnische Orthographie basiert auf dem Lateinischen Alphabet, welches um Buchstaben mit diakritischen Zeichen erweitert wurde. Dazu gehören Ą, Ć, Ę, Ł, Ń, Ó, Ś, Ź und Ż. Die Buchstaben Q, V und X sind offiziell Bestandteile des polnischen Alphabets, kommen aber nur in Fremdwörtern vor. Die Polnischen Dialekte werden traditionell in fünf Gruppen eingeteilt; das Großpolnische, das Kleinpolnische, das Masowische, das Schlesische und das Kaschubische. Hinzu kommen sogenannte gemischte Dialekte in den Gebieten, welche durch die Umsiedlung von Polen nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden.[42]Kaschubisch wird auch als eigenständige Sprache betrachtet.[42] Auch wenn im Alltagsleben seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs Polnisch dominierte, war Latein bis ins 18. Jahrhundert die Verwaltungs-, Kirchen- und Schulsprache.[42] Daneben war in der Adelsrepublik Ruthenisch offiziell anerkannt. Die ältesten heute bekannten polnischen Schriftzeugnisse sind Namen und Glossen in lateinischen Schriftstücken, insbesondere in der Bulle von Gnesen des Papstes Innozenz II. von 1136, in der fast 400 einzelne polnische Namen von Ortschaften und Personen auftauchen. Den ersten geschriebenen vollständigen Satz fand man in der Chronik des Klosters Heinrichau bei Breslau. Unter den Einträgen des Jahres 1270 findet sich eine Aufforderung eines Mannes zu seiner mahlenden Frau. „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj“, was in der Übersetzung lautet: „Lass mich jetzt mahlen, und du ruh dich aus.“ In der Literatur war Polnisch ab dem 14. Jahrhundert und verstärkt ab dem 16. Jahrhundert in Gebrauch.[42] Im 16. Jahrhundert entwickelte sich auch ein Standardpolnisch.[42] Während der Teilungen Polens Ende des 18. bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das Polnische durch Russisch bzw. Deutsch verdrängt. Mit dem 1918 wiederentstandenen polnischen Staat wurde die polnische Sprache zur Amtssprache. Damals sprachen etwa 65 % Polnisch als Muttersprache, die restliche Bevölkerung sprach Ukrainisch, Weißrussisch, Deutsch, Jiddisch und andere. Nach der Westverschiebung der Grenzen ist Polen seit Ende der 1940er Jahre erstmals seit dem Hochmittelalter ein ethnisch relativ homogener Staat. Etwa 95 % bis 98 % der Bevölkerung sind Polen, und entsprechend groß ist die Dominanz der polnischen Sprache. Es gibt eine Reihe von Minderheitensprachen, die seit 2005 offiziell anerkannt sind[43]: Kaschubisch in der Kaschubei und als nationale Minderheitensprachen: Armenisch, Deutsch, Hebräisch, Jiddisch, Litauisch, Russisch, Slowakisch, Tschechisch, Ukrainisch und Weißrussisch sowie als ethnische Minderheitensprachen: Karaimisch, Russinisch bzw. Lemko, Romani und Tatarisch.
Religionen

Krakauer Idol von Sbrutsch
Laut einer repräsentativen Umfrage des Eurobarometers glaubten im Jahr 2005 80 % der Menschen in Polen an Gott, weitere 15 % glaubten an eine andere spirituelle Kraft.[44][45]
Slawische Mythologie
Die polnischen Stämme waren ursprünglich Heiden und hatten, ähnlich wie andere Westslawen, ein polytheistisches Religionssystem, dessen Hauptgott der vierköpfige Świętowit war, dessen Statuen zwischen Pommern (z. B. bei Kap Arkona auf Rügen) und der Ukraine (z. B. der „Antichrist aus dem Zburz“) gefunden wurden. Diese Religion konnte sich teilweise bis ins 14. Jahrhundert behaupten. Insbesondere im Nordosten wurde auch ein Ahnenkult gepflegt, der teilweise bis ins 19. Jahrhundert überdauerte und in der Romantik unter anderem von Adam Mickiewicz in seinem Drama Totenfeier wieder aufgegriffen wurde. In kleinem Umfang besteht ein Bestreben, die alten Kulte wieder zu belegen. Hierbei handelt es sich aber eher um ein kulturelles als um eine religiöses Phänomen.
Katholische Kirche

Basilika in Licheń

Rakówer Dreifaltigkeitskirche
Im Jahre 965 heiratete der Herzog von Polen, Mieszko I., die böhmische Prinzessin christlichen Glaubens Dubrawka und ließ sich im folgenden Jahr nach lateinischem Ritus taufen. Das erste Bistum wurde 968 in Posen gegründen. Die Kirchenordnung wurde im Jahr 1000 neuorganisiert und das Erzbistum Gnesen mit den untergeordneten Bistümern in Kolberg, Krakau, Posen und Breslau wurden gegründet. In der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts kam es zu einem großen heidnischen Aufstand gegen den christlichen Klerus. Nachdem der polnische Adel im Zuge der Reformation in großen Scharren zum Calvinismus wechselte, im Sejm sogar um 1550 eine protestantische Mehrheit bestand, vermochte die katholische Kirche im 17. Jahrhundert im Zuge der Gegenreformation die meisten andersgläubigen Adeligen wieder zum katholischen Glauben zu bekehren. Seit dem Zweiten Weltkrieg und der Westverschiebung Polens ist das Land größtenteils katholisch. 87 % der polnischen Gesamtbevölkerung sind römisch-katholisch (Anteil der katholisch Getauften an Gesamtbevölkerung, 2011),[46] vor 1939 waren es nur 66 %.[47] Davon geben 54 % an, ihren Glauben auch zu praktizieren.[47] Ein besonders hohes Ansehen in Polen besitzt der verstorbene Papst Johannes Paul II. (1920–2005), der vor seiner Papstwahl als Karol Wojtyła Erzbischof von Krakau war und eine bedeutende politische Rolle während des Zusammenbruchs des Ostblocks innehatte.[48]
Orthodoxe Kirche

Orthodoxe Newski-Kathedrale 1912
Die polnischen Stämme kamen wahrscheinlich im 9. Jahrhundert über das Großmährische Reich mit dem christlichen Glauben erstmals in Kontakt. Die Wislanen in Kleinpolen wurden zur Zeit der byzantinischen Slawenapostel Kyrill und Method von den Herrschern des Großmährischen Reiches unterworfen. Mährischen Chronisten zufolge soll bereits zu dieser Zeit das Christentum nach slawischem Ritus in der Region um Krakau eingeführt worden sein. In den östlichen Woiwodschaften Polens hat ab dem 14. Jahrhundert stets die orthodoxe Kirche dominiert. Durch die Union mit Litauen 1386 und 1569 kamen viele weißrussisch- und ukrainischsprachige orthodoxe Christen unter die Herrschaft der polnischen Könige. Die Polnisch-Orthodoxe Kirche ist auch heute noch die zweitgrößte Religionsgemeinschaft in Polen. Zu ihr bekannten sich 2006 0,5 Millionen Menschen, was 1,3 % der Bevölkerung entspricht. Vor 1939 gehörten noch 11 % der Bevölkerung zur orthodoxen Kirche.[49]
Griechisch-katholische Kirche

Griechisch-katholische Johannes-Kathedrale in Przemyśl
Ca. 0,2 % der Bevölkerung sind griechisch-katholisch.[50] Die Griechisch-katholische Kirche ist 1596 in Polen durch die Kirchenunion von Brest entstanden. Sie hatte vor allem in dem polnischen Teil der Ukraine eine hohe Verbreitung. Nach den polnischen Teilungen wurde die Griechisch-katholische Kirche in Russland besonders hart verfolgt. Mit der Zuwanderung von Ukrainern nach Polen seit dem Ukrainekrieg in Donbas wächst die griechisch-katholische Gemeinde wieder rasant.
Reformierte Kirche
Während das Luthertum bei dem Bürgertum Anhänger fand, war der Calvinismus beim Kleinadel, der Szlachta, beliebt. Calvin selbst korrepondierte lange Zeit mit dem polnischen König Sigismund II. August, der eine gewisse Zeitlang den Bestrebungen der Mehrheit des polnischen Sejm zugeneigt war, eine Nationalkirche nach englischem Vorbild in Polen-Litauen zu etablieren, die nach der Lehre Calvins konzipiert sein sollte. Der Sejm von 1555 debattierte über die Einführung einer protestantischen Nationalkirche in Polen. Statt eine solche zu gründen, gewährte Sigismund II. August seinen Untertanen die Glaubensfreiheit mit dem Argument, er wäre der König seiner Untertanen und nicht der König der Gewissen seiner Untertanene. Die Glaubensfreiheit wurde schließlich als Reaktion auf die Pariser Bartholomäusnacht in der Konföderation von Warschau 1573 zu einem Verfassungsprinzip der Adelsrepublik erhoben, die der neugewählte polnische König aus Frankreich in den Articuli Henriciani und alle seine Nachfolger in der Pacta conventa unterzeichnen musste. Die Sicherung der individuelle Glaubensfreiheit in der polnischen Verfassung war ausschlaggebend dafür, dass es in Polen nie zu Religionskriegen kam. Der Calvinismus war bis Mitte des 17. Jahrhunderts beim polnischen Adel weit verbreitet. Heute spielt er aufgrund der Gegenreformation im 17. Jahrhundert kaum eine Rolle mehr.
Polnische Brüder
Die Polnischen Brüder waren Antitrinitarier, die als Teil der Radikalen Reformation unter dem Einfluss Lehre des Sozinianismus die Dreieinigkeit und somit die Gotteigenschaft Jesu ablehnten. Aus der Reformierten Kirche entstand 1565 die unitarische Kirche der Polnischen Brüder, die in Raków über eine eigene Akademie verfügten und stark von Fausto Sozzini und dem Sozinianismus beeinflusst waren. Gemäß dem Rakauer Katechismus lehnten sie jede Form von Gewalt ab, darunter auch den Kriegsdienst. Die Polnischen Brüder gibt es heute nicht mehr. An der Stelle der ihrer ehmeligen Hauptkirche in Raków befindet sich heute die katholische Dreifaltigkeitskirche aus dem Barock.
Evangelisch-lutherisch Kirche

Lutherische Dreifaltigkeitskirche
Das Luthertum fand seit dem 16. Jahrhundert besonders bei der deutschen Bevölkerung in den nordpolnischen Städten viele Anhänger. Heute ist Warschau und die Region um Teschen, wo ca. ein Drittel der Bevölkerung Lutheraner sind, das Zentrum der evangelisch-lutherischen Kirche in Polen. Ca. 0,2 % der Bevölkerung sind evangelisch-lutherisch.[50]
Mariaviten
Eine kleine Minderheit bilden die altkatholischen Mariaviten. Die Katholische Kirche der Mariaviten wurde in den 1930er Jahren in Polen gegründet.
Polnisch-Katholische Kirche
Eine kleine Minderheit bilden die Polnisch-Katholischen, die entgegen ihrem Namen eine protestantische Glaubensrichtung sind, die im 19. Jahrhundert in den USA entstanden und im 20. Jahrhundert durch Reemigration nach Polen gekommen ist.
Altkatholische Kirche
Die Altkatholische Kirche in Polen ist ebenfalls wie die Polnisch-Katholische Kirche aus den USA durch Reemigration nach Polen gekommen.
Zeugen Jehovas
Ca. 0,3 % der Bevölkerung sind Zeugen Jehovas.[50]
Islam

Islamischer Friedhof Kruszyniany

Synagoge im POLIN-Museum
In Polen gibt es zwei muslimische Gemeinden. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts siedelte der polnische König Jan Sobieski muslimische Tataren in Podlachien an. Eine relativ große muslimische Minderheit lebte auch um Kamieniec Podolski in Podolien, das zwischen 1672 und 1699 zum Osmanischen Reich gehörte. Die zweite muslimische Gemeinde bilden eingewanderte Muslime, die meist aus arabischen Ländern und der Türkei stammen. Deren regligiöses Zentrum bildet vor allem Warschau und Danzig.
Judentum
Polen war im Mittelalter nie religiös homogen. Noch bevor sich der christliche Glaube endgültig durchsetzen konnte, wanderten in den nächsten Jahrhunderten, begünstigt durch das Toleranzedikt von Kalisz von 1265 Juden aus Westeuropa und Hussiten aus Böhmen nach Polen ein. Kasimir der Große weitete das Toleranzedikt von Kalisz auf ganz Polen aus. Die polnischen Juden sind seit dem 18. Jahrhundert in zwei dominierende Glaubensrichtungen getrennt, die aufgeklärten Haskalen und die orthodoxen Chassiden. Zeitweise lebten mehr als die Hälfte aller Juden weltweit in Polen. Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte Polen mit Abstand die größte jüdische Gemeinde weltweit. Die jüdische Gemeinde wurde nach der Wende 1989 wiederbelebt.
Geschichte

Bronzezeitliches Biskupin

Westslawische Stämme

Matejkos Taufe Polens 966

Schlacht bei Liegnitz 1241
Urgeschichte
Die Urgeschichte des heutigen Polens reicht bis in das Paläolithikum zurück. Im Neolithikums befand es sich nacheinander im Einflussbereich der Linearbandkeramischen Kultur, Trichterbecherkultur, Kugelamphoren-Kultur und der Schnurkeramische Kultur. Während der Bronzezeit war es Teil der Lausitzer Kultur beziehungsweise der Hallstattkultur, aus der die Pfahlbausiedlung Biskupin stammt. Sie wird auch mit der Hallstattkultur in Verbindung gebracht. Am Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit folgte die Pommerellische Gesichtsurnenkultur und in der späten Eisenzeit die Wielbark-Kultur. In der Antike geriet das Gebiet des heutigen Polens unter keltischen und thrakischen Einfluss. Später dominierte die Przeworsk-Kultur. Über die Bernsteinstraße fand ein reger kultureller Austausch mit dem Römischen Reich statt. Die Römer erwähnten bereits um Christi Geburt die Städte Kalisz und Truso. Goten und Vandalen siedelten um Christi Geburt aus Skandinavien kommend zeitweise im heutigen Nord- und Westpolen. Während der Völkerwanderung zogen Westslawen und Balten durch das heutige Polen. Vor der polnischen Staatsgründung unternahmen die Wikinger, Awaren und Magyaren Raubzüge ins heutige Polen. Mit dieser Zeit verbindet man auch die Sagen um die ersten Urfürsten Polens Popiel, Piast, Lech und Siemowit. Südpolen geriet in der zweiten Hölfte des 9. Jahrhunderts unter mährischen Einfluss.
Piasten
Das Herzogtum Polen, dessen Name sich vom westslawischen Stamm der Polanen ableitet, ist im frühen 10. Jahrhundert von Großpolen (Posen, Giecz, Ostrów Lednicki und Gnesen) aus gegründet worden. Es wurde von ca. 960 bis 992 von Herzog Mieszko I. aus der Dynastie der Piasten regiert, der nach und nach die anderen westslawischen Stämme zwischen Oder und Bug unterwarf. Um 990 stellte er in dem Dokument Dagome Iudex Polen unter den unmittelbaren dem Papst Johannes XV.
966 ließ sich Mieszko I. nach römisch-katholischem Ritus taufen. Das Territorium erreichte durch Eroberungen unter Mieszko I. Grenzen, die den heutigen Staatsgrenzen sehr nahe kamen. Sein Sohn Boleslaus I. der Tapfere war der erste polnische König. Bereits 997 schloss er ein politisch-militärisches Bündnis mit dem römisch-deutschen Kaiser Otto III., das während des Akts von Gnesen im Jahr 1000 bestätigt wurde. Nach dem frühen Tod des jungen Otto III. verschlechterte sich das Verhältnis unter Heinirch II., mit dem Boleslaus I. zahlreiche Kriege um die Lausitz führte. Boleslaus I. dehnte zeitweise seinen Einflussbereich auf die heutige Slowakei, Böhmen und Mähren sowie die Kiewer Rus aus. Unter der Herrschaft seines Sohnes Mieszko II. Lambert kam es in den späten 1030er Jahren zu einem heidnischen Aufstand der Polen gegen die katholische Kirche. Erst dessen Nachfolger Kasimir I. der Erneuerer vermochte die Lage zu beruhigen. Er verlegte 1040 die Hauptstadt von Gnesen auf den Krakauer Wawel.
Nach dem Tod von Boleslaus III. Schiefmund im Jahr 1138 wurde die Senioratsverfassung eingeführt, nach welcher die Söhne von Boleslaus III. als Juniorherzöge unter dem Seniorat des Ältesten der Dynastie die ihnen unterstehenden einzelnen Landesteile regierten. Bis 1295 dauerte diese feudale Zersplitterung in Polen an. Dieser sogenannte Partikularismus führte zu einer starken politischen Schwächung Polens im 13. Jahrhundert. Polen zerfiel 1138 in sechs Herzogtümer: Kleinpolen, Großpolen, Pommern, Pommerellen, Schlesien und Masowien, das sogenannte „Seniorat Polen“. Die Jahre bis zur Wiedervereinigung waren durch feudalistische Territorialzersplitterung geprägt. Das im Südosten gelegene Gebiet Kleinpolens zerfiel in das Adelsterritorium Sandomierz, das östliche Großpolen in die Herzogtümer Łęczyca und Sieradz, das westliche Masowien in das Herzogtum Kujawy. In Westpommern erlangten die Greifen 1181 und in Pommerellen die Samboriden 1227 die Unabhängigkeit von dem Krakauer Senior. 1295 gelang es Przemysł II. aus der großpolnischen Linie der Piasten große Landesteile wieder zu vereinen und sich zum König von Polen krönen zu lassen. Er wurde jedoch bereits im Folgejahr ermordet, und die polnische Königskrone fiel an die böhmischen Přemysliden Wenzel I. und Wenzel II. Nachdem letztere auf der Fahrt zur Krönung in Krakau ermordet wurde, gelang es Ladislaus I. Ellenlang aus der kujawischen Linie der Piasten die polnische Königskrone zu erlangen. Mit seinem Sohn Kasimir III. dem Großen starben die Piasten in der Königslinie 1370 aus, wobei die masowischen Piasten erst 1526 und die schlesischen Piasten sogar erst 1707 ausstarben. Der letzte Piastenkönig Kasimir III. der Große leitete erfolgreich Reformen ein, die dem Königreich Polen zu einer machtvollen Position in Mittel- und Osteuropa verhalfen.
Die Piasten holten zahlreiche Siedler nach Polen, zunächst den Klerus und die Benediktiner sowie Zisterzienser aus Frankreich, dem Heiligen Römischen Reich sowie Italien, und insbesondere nach der Entvölkerung weiter Teile Polens im Zuge des Mongolensturm in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts deutsche Bauern und Stadtbürger, sowie insbesondere Juden nach den Pogromen in Westeuropa im Zuge der Pestepidemie in der Mitte des 14. Jahrhunderts, von der Polen verschont blieb. Konrad I. von Masowien holte den Deutschen Orden 1226 ins Kulmer Land, von wo er aus Preußen unterwarf. Kasimir III. der Große erstreckte hingegen das jüdische Toleranzedikt von Kalisch von Boleslaus VI. des Frommen auf das ganze Königreich Polen. Er begann auch mit dem Anschluss des Fürstentum Halytsch-Wolodymyr mit Lemberg die polnische Ostexpansion. Mit dem böhmischen Luxemburgern, die weiterhin den von den Přemysliden geerbten Anspruch auf die polnische Krone geltend machten, konnte sich Kasimir III. der Große nach Treffen in Visegrád und Krakau im Vertrag von Namslau einigen, die Luxemburger verzichteten auf die polnische Krone und die kujawischen Piasten auf die Lehenshoheit über Schlesien. 1364 gründete Kasimir III. der Große die Krakauer Akademie als zweite Universität in Mitteleuropa. Gleichzeitig schloss Kasimir III. der Große ein militärisches Bündnis mit dem ungarischen König Karl I. und einen Erbvertrag mit dessen Sohn Ludwig I. aus dem Haus Anjou, der die Schwester Kasimirs III. des Großen Elisabeth von Polen heiratete und damit einen Anspruch auf die polnische Krone nach Kasimirs III. Tod erwarb.
Jagiellonen

Jagiellonen-Machtbereich um 1500
Dem ohne legitimen Sohn verstorbenen Kasimir III. dem Großen folgte durch Erbvertrag dessen Schwager Ludwig I. aus dem Haus Anjou, wodurch es zur ersten polnisch-ungarischen Personalunion kam, sowie dessen Tochter Hedwig I. Diese heiratete 1386 den frisch getauften litauischen Großfürst Ladislaus II. Jagiełło, wodurch der mächtige Doppelstaat Polen-Litauen geschaffen wurde, der für die nächsten 400 Jahre die Geschicke Mittel- und Osteuropas entscheidend beeinflusste. Nach der Schlacht bei Tannenberg und der damit verbundenen schweren Niederlage des Deutschen Ordens stieg Polen-Litauen zu einer der führenden Kontinentalmächte auf und war lange Zeit der größte Staat Europas mit Einflusssphären vom Baltischen zum Schwarzen Meer und von der Adria bis an die Tore Moskaus. Unter Ladislaus II. Jagiełłos ältesten Sohn Ladislaus III. kam es zur zweiten polnisch-ungarischen Personalunion, die mit Ladislaus III. Tod in der Schlacht bei Warna endete. Sein Bruder Kasimir IV. Andreas konnte im Dreizehnjährigen Krieg dem Deutschen Orden Westpreußen und Ermland abgewinnen und den restlichen Ordensstaat zu einem polnischen Lehen machen. Durch eine geschickte Dynastie und Heiratspolitik machte er die Jagiellonen zu einer der führenden Königsfamilien in Europa. Sein ältester Sohn Ladislaus wurde König von Böhmen und Ungarn und seine jüngeren Söhne Johann I. Albert, Alexander I. und Sigismund I. der Alte wurden nacheinander Könige und Großfürsten in Polen-Litauen. Seine Töchter vermählte er mit den bayerischen Wittelsbachern, preußischen Hohenzollern, pommerschen Greifen, den sächsischen Wettinern sowie den schlesischen Piasten. Als also Sigismund I. der Alte 1525 den Deutschen Ordensstaat auflöste und in ein weltliches Herzogtum umwandelte, setzte er mit Albrecht seinen Neffen als Herzog ein. 1526 fiel das bisherige polnische Lehen Masowien mit dem Tod des letzten masowischen Piasten Janusz III. wieder an Polen. Mit dem Tod Ludwig II. in der Schlacht bei Mohács verloren die Jagiellonen Böhmen, Ungarn und Kroatien an die Osmanen beziehungsweise Habsburger. Mit Sigismund I. des Alten einzigem Sohn Sigismund II. August starben auch die Jagiellonen 1572 im Mannesstamm und mit seiner Tochter Anna Jagiellonica 1596 vollständig in Polen-Litauen aus.
Adelsrepublik

Polen-Litauen um 1670
Polen wurde 1358 als Republik bezeichnet. Die republikanische Staatsform setzte sich aber wohl erst um die Mitte des 15. Jahrhunderts durch und war mit einem stetigen Dreikammerparlament erst Ende des 15. Jahrhunderts ausgereift. Mit der 1505 verabschiedeten Verfassung Nihil Novi verbot der Sejm dem König neue Gesetze ohne Zustimmung des Parlaments zu erlassen. Auf Betreiben des letzten polnischen Königs aus der Jagiellonen-Dynastie, Sigismund II. August, wurde die Personalunion zwischen Polen und Litauen in Lublin im Jahr 1569 in eine Realunion umgewandelt. Polen und Litauen bildeten seit 1569 die gemeinsam eine Adelsrepublik und damit den ersten modernen Staat Europas mit einem adelsrepublikanischen System und einer Gewaltenteilung. 1578 wurde ein vom König und dem Sejm unabhängiges Höchstes Gericht für Polen-Litauen, das Krontribunal in Lublin eingerichtet. Der polnische Adel wählte zunächst den Franzosen Heinrich I. Valois, dem er die Religionsfreiheit abverlangte, und später den Siebenbürger Stephan I. Báthory zum polnisch-litauischen König. Später folgten drei Könige aus der mit den Jagiellonen verwandten schwedischen Vasa-Dynastie Sigismund III. Vasa (kurze Personalunion mit Schweden), Ladislaus IV. Vasa (kurze Personalunion mir Russland) sowie Johann II. Kasimir. Mit Michael I. Korybut Wiśniowiecki, Johann III. Sobieski und Stanislaus I. Leszczyński wurden polnische Magnaten und mit August II. dem Starken und August III. sächsische Wettiner gewählt. Der letzte gewählte polnische König war Stanislaus II. August Poniatowski. Als Goldenes Zeitalter der Adelsrepublik gilt die Zeit bis zur Hälfte des 17. Jahrhunderts. Danach war Polen-Litauen in zahlreiche Kriege verwickelt, unter anderem in die Schlacht am Kahlenberg im Rahmen des Großen Türkenkriegs.
Teilungen

Teilungen 1772, 1793, 1795

Verfassung vom 3. Mai

Ajdukiewiczs Januaraufstand
Die Adelsrepublik stürzte im 17. und 18. Jahrhundert in eine dauerhafte Krise, die durch zahlreiche Kriege (mit Schweden, dem Osmanischen Reich, Russland, Brandenburg-Preußen und Siebenbürgen), fehlende politische Reformen und innere Unruhen gekennzeichnet war. Es kam zur Bildung von Magnaten (sogenannten Konföderationen gegen die Interessen des Staates und des Königs), Kosakenaufständen und dauerhaften Konfrontationen mit den Krimtataren in den südöstlichen Woiwodschaften. Besonders die Wahl ausländischer Dynasten zu polnischen Königen (sie verfügten über keine Hausmacht in Polen und waren vom Wohlwollen des Hochadels abhängig) und die Uneinigkeit innerhalb des polnischen Adels, der Szlachta und Magnaten, schwächten den Staat beträchtlich. Insbesondere die so genannte Sachsenzeit wird dabei aus polnischer Sicht als negativ für den weiteren Bestand des polnischen Staates eingestuft.
Auch die Ratifizierung einer Verfassung 1791, der ersten modernen Verfassung Europas überhaupt, konnte den Niedergang der polnisch-litauischen Adelsrepublik nicht stoppen. In den drei Teilungen Polens 1772, 1793 und 1795 wurde Polens innere Schwäche von seinen Nachbarn Preußen, Österreich und Russland ausgenutzt, welche Polen gleichzeitig überfielen und am Ende unter sich aufteilten. Polen wurde damit seiner Souveränität beraubt und sein ursprüngliches Landesgebiet in drei unterschiedliche Staaten eingegliedert. Der letzte polnische König Stanislaus II. August Poniatowski musste abdanken und wurde nach Sankt Petersburg gebracht, wo er 1798 verstarb. Zeitgleich wurden jedoch bereits ab 1796 Polnische Legionen im französisch besetzten Norditalien und Frankreich unter Jan Henryk Dąbrowski gegründet, deren Ziel es war, mit französischer Hilfe die polnisch-litauische Republik wieder zu errichten.
Auf Drängen des französischen Kaisers Napoleon entstand 1807, im Rahmen des Friedens von Tilsit, aus den preußischen Erwerbungen der Zweiten und Dritten Teilung ein relativ kleines Herzogtum Warschau, als Vasallenstaat Frankreichs. Im Jahr 1809 wurden nach kurzen kriegerischen Auseinandersetzungen Teile Kleinpolens im damaligen Westgalizien von Österreich an das Herzogtum Warschau wieder abgetreten. Aufgrund der Niederlagen der polnisch-französischen Allianz im Russlandfeldzug 1812 und in der Völkerschlacht bei Leipzig im Jahr 1813 kam es zu keiner Wiederherstellung der polnisch-litauischen Republik und das Herzogtum Warschau wurde auf dem durch die Teilungsmächte dominierten Wiener Kongress aufgeteilt. Große Teile Großpolens fielen als Provinz Posen wieder an Preußen. Krakau wurde zum Stadtstaat, der bis 1846 formal unabhängigen Republik Krakau. Der Rest, das nach dem Wiener Kongress benannte Kongresspolen, wurde als Königreich Polen 1815 in Personalunion mit dem Russischen Kaiserreich verbunden, war also zunächst formal bis auf den gemeinsamen Herrscher vom russischen Reich unabhängig. Bis 1831 genoss dieses polnische Staatswesen weitgehende Autonomie. Mit dem Aufkommen des russischen Nationalismus beim Übergang von der Feudalgesellschaft zum Kapitalismus wurde durch die zaristische Verwaltung versucht, diese Autonomie Schritt für Schritt abzuschaffen.
Als Folge der Rekrutierung von Polen für die russische Armee zur Bekämpfung der Belgischen Revolution brach in Warschau der Novemberaufstand von 1830 aus, in dem die Polen versuchten, die russische Fremdherrschaft und Dominanz abzuschütteln. Der Novemberaufstand wurde 1831 von der russischen Armee niedergeschlagen. Mit der Niederlage wurde die polnische Bevölkerung seit 1831 in den preußischen und russischen Besatzungszonen einer verstärkten Germanisierung – den preußischen Volkszählungen zufolge ohne größere Auswirkungen auf die Bevölkerungsverhältnisse – und Russifizierung unterzogen, die nach dem zweiten, gescheiterten Aufstand, dem Januaraufstand von 1863, besonders forciert wurde. Die Bezeichnung Polen wurde verboten und das Land durch die russische Obrigkeit als Weichselland bezeichnet. Ähnlich verfuhren auch die Hohenzollern in Pommerellen und Großpolen: In Volkszählungen tauchen Polen als Nationalität auf, aber als zeitgenössischer geographischer Begriff wird Polen in preußischen Schulbüchern und allen deutschsprachigen Kartenwerken auf den russischen Teil beschränkt. Nur im von Österreich besetzten polnischen Galizien konnten die Polen durch die politischen Reformen des Hauses Habsburg-Lothringen in der Donaumonarchie seit 1867 der geistig-nationalen Unterdrückung in den von Preußen und Russland dominierten Teilen Polens entkommen. Im russischen Teil hingegen bildete die Revolution von 1905 einen Wendepunkt, in dem zunächst sozialistische Forderungen dominierten, später aber die Forderung nach nationaler Unabhängigkeit an Boden gewann.[51]
Stanislaus II. August Poniatowski

Stanisław Kostka Potocki

Kazimierz Pułaski
Hugo Kołłątaj

Tadeusz Kościuszko
Józef Antoni Poniatowski

Jan Henryk Dąbrowski

Adam Jerzy Czartoryski

Romuald Traugutt
Erster Weltkrieg

Warschauer Kronenberg-Palast
Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges gründeten die Mittelmächte, insbesondere Österreich-Ungarn, Polnische Legionen unter dem Kommando von Józef Piłsudski. Während des Ersten Weltkrieges beschlossen die Kaiserreiche Deutschland und Österreich-Ungarn die Gründung eines selbstständigen polnischen Staates auf dem dem russischen Zarenreich abgenommenen Territorium Kongresspolens. Dies war aber eher eine gegen Russland gerichtete Maßnahme als die Anerkennung des Rechts aller Polen auf Eigenstaatlichkeit seitens der Mittelmächte. 1916 wurde das in Analogie zum Entschluss des Wiener Kongresses benannte Regentschaftskönigreich Polen durch das Deutsche Reich ausgerufen. Hierzu wurde der Provisorische Staatsrat im Königreich Polen eingesetzt, der 1916 bis 1918 im Warschauer Kronenberg-Palast tagte und den das Triumvirat Józef Ostrowski, Aleksander Kakowski und Zdzisław Lubomirski leitete. Durch die Kriegsereignisse bedingt, hatte der Provisorische Staatsrat im Königreich Polen nur begrenzte praktische Auswirkungen. Allerdings legten Józef Piłsudski und seine Legionen nach der russischen Oktoberrevolution 1917 die Waffen nieder und weigerten sich, weiter für die Mittelmächte zu kämpfen, da das Kriegsziel der Polnischen Legionen mit der Niederlage Russlands bereits erreicht war. Józef Piłsudski wurde darauf in Magdeburg interniert. Seine Rückkehr nach Polen nach der Niederlage der Mittelmächte war der Anlass für die Ausrufung der unabhängigen Zweiten Polnischen Republik am 11. November 1918 in Warschau. Neben Piłsudski, der dem sozialistischen Lager entstammte, waren auch Roman Dmowski und Ignacy Jan Paderewski, die aus dem bürgerlichen Lager stammten, für die polnische Unabhängigkeit am Ende des Ersten Weltkriegs aktiv.

Józef Piłsudski

Roman Dmowski

Ignacy Jan Paderewski

Józef Haller

Kazimierz Sosnkowski

Szymon Askenazy

Józef Ostrowski
Aleksander Kakowski

Zdzisław Lubomirski
Zweite Republik

Polen nach dem Frieden von Riga

Maiputsch 1926

Luxtorpeda in Zakopane 1936
Woodrow Wilson machte bereits 1917 beim Kriegseintritt der USA in dem 14-Punkte-Programm klar, dass ein unabhängiges Polen mit Zugang zur Ostsee eines der Kriegsziele der USA ist. Nach der Niederlage der Mittelmächte erlangte Polen seine Souveränität zurück. Am 11. November 1918 wurde die Zweite Polnische Republik ausgerufen. Das allgemeine Frauenwahlrecht wurde noch im selben Monat in dem Dekret über das Wahlverfahren für den Sejm vom 28. November 1918 eingeführt: Artikel 1 garantierte das aktive, Artikel 7 das passive Wahlrecht.[52] Im Friedensvertrag von Versailles wurde die Unabhängigkeit der Republik Polen 1919 im internationalen Rahmen bestätigt. Polen war damit Gründungsmitglied des Völkerbundes. Gleichzeitig wurde im polnischen Minderheitenvertrag vom 28. Juni 1919 der Schutz der deutschen Minderheit in Polen vereinbart.
Durch die Siegermächte wurden in Mittel- und Osteuropa Grenzen nach Bevölkerungsmehrheiten vorgesehen. Federführend war dabei der britische Außenminister Lord George Nathaniel Curzon. Die Weimarer Republik war gezwungen, die preußischen Provinzen Westpreußen und Posen größtenteils aufzugeben. Sie waren im Rahmen der Teilungen Polens vom Königreich Preußen annektiert worden. Unmittelbar danach verließen 200.000 Deutsche die der Republik Polen zugesprochenen Gebiete.
Aufgrund der unklaren politischen Verhältnisse nach dem Zusammenbruch der Hohenzollern- und Romanow-Monarchien kam es während der ersten Konsolidierungsphase des neuen Staates zu Konflikten mit den Nachbarstaaten, zum Beispiel mit Deutschland um Oberschlesien in der Schlacht um St. Annaberg oder um die Stadt Wilna im heutigen Litauen.
Ab März 1919 gelang es Polen im Polnisch-Sowjetischen-Krieg, weite Teile der Ukraine und Weißrusslands einzunehmen. Es folgte eine sowjetische Gegenoffensive, die anfangs erfolgreich war. In der Schlacht bei Warschau im Jahre 1920 wurde die Rote Armee jedoch unter hohen Verlusten zurückgeworfen, worauf sie sich bis in die Ukraine zurückzog. Nach dem Sieg Marschall Józef Piłsudskis gegen die Bolschewiken an der Weichsel wurde im Friedensvertrag von Riga am 18. März 1921 Polens Ostgrenze etwa 250 km östlich der Curzon-Linie festgelegt.
Die Curzon-Linie markierte die östliche Grenze des geschlossenen polnischen Siedlungsgebietes, während die östlichen Gebiete (Kresy) eine gemischte Bevölkerungsstruktur aus Polen, Ukrainern, Weißrussen, Litauern, Juden und Deutschen aufwiesen, wobei die Polen in vielen Städten und die anderen Bevölkerungsgruppen auf dem Land dominierten. Während die Bevölkerungsmehrheit der Städte meist römisch-katholisch oder jüdisch war, war die Landbevölkerung überwiegend orthodox. Gleichwohl verfehlte Piłsudski sein Ziel, die Ukraine als unabhängigen „Pufferstaat“ zwischen Polen und Sowjetrussland zu etablieren. In Riga erkannte Polen die Ukraine als Teil der späteren Sowjetunion unter Mykola Skrypnyk an. In den von Sowjetrussland Polen zugesprochenen Gebieten, östlich des Westlichen Bugs, bildeten die Polen 1919 25 % der Bevölkerung, 1939 waren es nach einer Ansiedlungspolitik mit Bevorzugung von Polen während der Amtszeit Piłsudskis bereits etwa 38 %. Polnische Sprachinseln im je nach Region mehrheitlich ukrainischen oder weißrussischen Umland waren die Regionen um Pinsk, Łuck, Stanisławów und Lemberg (Lwów). Insgesamt waren in dem Gebiet 1939 von 13,5 Millionen Einwohnern etwa 3,5 Millionen Polen. Die Rajongemeinde Vilnius ist bis heute mehrheitlich polnischsprachig geblieben und die Stadt Vilnius bildet nach der Zwangsumsiedlung ihrer polnischen Stadtbewohner nach dem Krieg eine litauische Sprachinsel.
Die innere Konsolidierung des neuen Staates wurde erschwert durch die Zersplitterung der politischen Parteien, die in der Teilungszeit entstandenen unterschiedlichen Wirtschafts-, Bildungs-, Justiz- und Verwaltungssysteme sowie durch die Existenz starker ethnischer Minderheiten (31 % der Gesamtbevölkerung). Außenpolitisch war Polen zunächst in das französische Allianzsystem einbezogen. Eine restriktive Politik gegenüber der deutschen Minderheit, die zur Emigration etwa einer Million deutschsprachiger Staatsbürger führte, die Weigerung der Regierung Stresemann, die neue deutsche Ostgrenze anzuerkennen, ein „Zollkrieg“ um die oberschlesische Kohle sowie der politisch-weltanschauliche Gegensatz zum Sowjetsystem schlossen eine Kooperation Polens mit seinen beiden größten Nachbarn aus.
Am 12. Mai 1926 gewann Marschall Piłsudski nach einem Staatsstreich die Macht (1926–1928 und 1930 als Ministerpräsident, 1926–1935 als Kriegsminister). Zur außenpolitischen Absicherung wurden Nichtangriffsverträge mit der Sowjetunion (1932) und dem Deutschen Reich (1934) geschlossen. Außenminister Józef Beck strebte den Aufstieg Polens zur ostmitteleuropäischen Hegemonialmacht im Rahmen eines neuen Europa von der Ostsee bis zur Adria an, seine Pläne scheiterten jedoch aufgrund der geopolitischen Lage. Trotz der Weltwirtschaftskrise 1939 konkte sich die Wirtschaft in der Zweiten Polnischen Republik entwickeln. Ergeizige Projekte wie der Bau der Hafenstadt Gdynia und der Zentralen Industrieregion konnten verwirklicht werden. Ein Zeichen des Luxuses der Zwischenkriegszeit waren die Schnellzüge Luxtorpeda, die unter anderem zwischen Krakau und dem immer beliebter werdenden Bergkurort Zakopane verkehrten.
Kurz bevor Polen selbst vom nationalsozialistischen Deutschland angegriffen wurde, stellte es im Zuge des Münchener Abkommens territoriale Forderungen an die Tschechoslowakei. Im Oktober 1938 annektierte Polen gegen den Willen der tschechischen Regierung das mehrheitlich von Polen bewohnte Olsagebiet, das 1919 von der Tschechoslowakei besetzt worden war.

Gabriel Narutowicz

Maciej Rataj

Stanisław Wojciechowski

Ignacy Mościcki

Wincenty Witos

Władysław Grabski
Wojciech Korfanty

Kazimierz Bartel

Józef Beck
Zweiter Weltkrieg

NS-Vernichtungslager

Warschauer Ghettoaufstand 1943

Warschauer Aufstand 1944
Im August 1939 schlossen das Deutsche Reich und die Sowjetunion den Hitler-Stalin-Pakt, in dessen geheimen Zusatzprotokoll der gemeinsame Überfall auf Polen, sowie die Annektierung der baltischen Staaten durch die Sowjetunion beschlossen wurden. Am 1. September 1939 wurde Polen vom Deutschen Reich angegriffen. Auch Truppen des deutschen Vasallenstaats Slowakei stießen auf polnisches Gebiet vor. Nachdem die westlichen Teile des Landes an die deutschen Invasoren verlorengegangen waren, begann ab 17. September unter dem Vorwand des „Schutzes“ der weißrussisch-ukrainischen Bevölkerung die sowjetische Besetzung Ostpolens. Die Annexion und Aufteilung des polnischen Staatsgebietes war zuvor in einem geheimen Zusatzprotokoll zum Hitler-Stalin-Pakt von den Diktatoren beschlossen worden. Damit nahm der Zweite Weltkrieg seinen Anfang, in dem 5,62 bis 5,82 Millionen polnische Staatsbürger, darunter fast die Hälfte jüdischer Abstammung, ihr Leben verlieren sollten.[53]
Mit dem Angriff Deutschlands auf Polen begann am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg. Am 17. September 1939 marschierte die Rote Armee in Ostpolen ein. Anschließend verließ die polnische Regierung in der Nacht vom 17. auf den 18. September 1939 über einen noch freien Grenzübergang Polen und begab sich ins neutrale Rumänien, später nach Paris und 1940 von dort aus nach London und organisierte von dort aus den Widerstand gegen die deutsche und sowjetische Besatzung.
Hitler machte frühzeitig klar, dass er die „Liquidierung des führenden Polentums“ (Reinhard Heydrich) ins Auge gefasst hatte. Allein in den ersten vier Monaten der deutschen Besatzungsherrschaft wurden mehrere 10.000 Menschen erschossen (Unternehmen Tannenberg). Anfang der 1940er Jahre errichteten die Nationalsozialisten mehrere Konzentrationslager auf dem Gebiet Polens, unter anderen die Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz, Majdanek und Treblinka. Die Besatzungszeit hatte für große Teile der polnischen Zivilbevölkerung katastrophale Folgen. In dem Land, in dem ursprünglich mehr als drei Millionen Juden lebten, führten die Nationalsozialisten einen so genannten „Volkstumskampf“, dem 5.675.000 Zivilisten zum Opfer fielen.[54] Polen wurde gemäß dem Hitler-Stalin-Pakt im Westen von der Wehrmacht und im Osten von der Roten Armee besetzt und zum Teil annektiert.
Zu den übergreifenden Zielen der Besatzungspolitik im gesamten Gebiet gehörte erstens die Ausschaltung und Vernichtung der polnischen Juden und der polnischen Intelligenz, zweitens die Vorverlegung der deutschen Ostgrenze und die Erweiterung des „Lebensraums im Osten“ (Generalplan Ost) und drittens die Stärkung der deutschen Kriegswirtschaft durch Ausbeutung des Arbeitskräftepotenzials der Zwangsarbeiter und der materiellen Ressourcen Polens. Großpolen, die 1919 an Polen abgetretenen Teile Westpreußens sowie Ostoberschlesien wurden direkt von Deutschland annektiert. Kleinpolen, Masowien und Galizien mit etwa zehn Millionen Menschen wurden als sogenanntes Generalgouvernement dem Reichsminister Hans Frank unterstellt. Er leitete die Vernichtungspolitik vom Wawel aus, dem Krakauer Königssitz der frühen polnischen Könige. Während seiner Regierungszeit organisierte er den Raub von Beutekunst aus polnischen Museen, Kirchen und Privatsammlungen in einem bisher nicht gekannten Ausmaß.
Auch die Polen, die unter sowjetische Herrschaft gerieten, waren von Gewaltmaßnahmen betroffen. Man schätzt, dass ungefähr 1,5 Millionen ehemalige polnische Bürger deportiert wurden. 300.000 polnische Soldaten gingen in sowjetische Kriegsgefangenschaft, nur 82.000 von ihnen überlebten. Ein Großteil der Offiziere, etwa 30.000 Personen, wurde durch sowjetische Truppen 1940 im Massaker von Katyn und in den Kriegsgefangenenlagern von Starobelsk, Koselsk und Ostaschkow ermordet. Bereits vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hatte Stalin in der Polnischen Operation des NKWD über 100.000 Polen in der Sowjetunion ermorden lassen. Das Morden der sowjetischen Kommunisten ging auch nach dem Zweiten Weltkrieg in dem erneut von der Sowjetunion besetzten Polen weiter.
Nachdem das Deutsche Reich die Sowjetunion 1941 angegriffen hatte, entstand im Hinterland der Sowjetunion aus polnischen Soldaten die Anders-Armee in Stärke von sechs Divisionen. Mangels Ausrüstung und Verpflegung wurden diese Einheiten jedoch bereits 1942 über Persien in den Nahen Osten verlegt, wo sie dem britischen Nahostkommando unterstellt wurden. Später kämpften sie als 2. Polnisches Korps in Palestina, Afrika und Italien, wo sie unter anderem das Kloster Monte Cassino von der Wehrmacht erobern konnten.
Polnische Soldaten kämpften auf Seiten der Alliierten an nahezu allen Fronten des Zweiten Weltkrieges von der Luftschlacht um England, in Afrika, der Sowjetunion, bis zur Invasion in der Normandie und in Italien. Die polnischen Soldaten stellten damit noch vor den Franzosen die viertgrößte Armee der Alliierten auf dem europäischen Kontinent. Polnische Partisanengruppen, welche die größte Widerstandsbewegung im besetzten Europa darstellten, leisteten auch in Polen selbst Widerstand. Nachdem die Rote Armee im Januar 1944 die polnische Grenze von 1939 überschritten hatte, wurden die Truppen der Heimatarmee vom NKWD entwaffnet, ihre Offiziere erschossen oder in den sowjetischen Gulag geschickt. Der Kampf einzelner Untergrundeinheiten gegen das von der Sowjetunion abhängige kommunistische Regime wurde bis Ende der 1940er Jahre fortgeführt.
Am 1. August 1944 begann auf Befehl der Londoner Exilregierung der Warschauer Aufstand. Die Sowjetunion, deren Truppen bereits am Ostufer der Weichsel standen, unterstützen die Einheiten der Heimatarmee fast gar nicht. Die große Entfernung machte eine effektive Hilfe der Westalliierten unmöglich. So konnten deutsche Besatzungstruppen die größte europäische Erhebung gegen sich niederschlagen. Die Zahl der Toten wird auf 180.000 bis 250.000 geschätzt. Danach wurde die Innenstadt Warschaus unter großem Einsatz an Sprengmaterial nahezu vollständig zerstört.

Edward Rydz-Śmigły

Władysław Sikorski

Stanisław Mikołajczyk

Tadeusz Bór-Komorowski

August Emil Fieldorf

Jan Karski

Witold Pilecki

Irena Sendler

Zofia Kossak-Szczucka
Volksrepublik

Westverschiebung Polens

Stalinpalast 1960
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 wurden die Grenzen des ehemaligen polnischen Staatsgebietes gemäß dem Potsdamer Abkommen nach Westen verschoben. Polen verlor das ethnisch gemischte, mehrheitlich von Ukrainern und Weißrussen bevölkerte Drittel seines bisherigen Staatsgebietes an die Sowjetunion. Die dort ansässige polnische Bevölkerung, etwa 1,5 Millionen Menschen, wurde als Repatrianten nach Polen vertrieben. Bereits in den Jahren 1943–1944 waren zehntausende Polen in den Massakern in Wolhynien ermordet worden, hunderttausende hatten flüchten müssen.
Im Westen und Norden wurden die deutschen Gebiete östlich der Oder und Neiße (Oder-Neiße-Linie) bis gemäß den Vorgaben der Konferenzen der Alliierten in Teheran, Jalta und Potsdam Polen zuerkannt. Etwa fünf Millionen Deutsche waren gegen Kriegsende von dort geflohen und wurden durch Einreiseverbot an einer Rückkehr gehindert; nach dem Krieg wurden weitere 3,5 Millionen Menschen vertrieben.[55] Einige deutsch- und polnischsprachige Oberschlesier und Masuren blieben in Polen. Viele, die deutsche Namen hatten, ließen diese in polnische Namen ändern. Der Gebrauch der deutschen Sprache wurde zwar nicht offiziell verboten, es wurde jedoch nicht gern gesehen, wenn man außerhalb der Familie deutsch sprach.
Die wiedergewonnenen Gebiete besiedelten drei Millionen Bürger aus Zentralpolen, etwa ein bis zwei Millionen Geflohene und Vertriebene aus Ostpolen und im Jahr 1947 etwa 150.000 durch die Aktion Weichsel aus dem Grenzgebiet zur Sowjetunion umgesiedelte Ukrainer und Ruthenen.
Mit dem Görlitzer Abkommen zwischen der neu entstandenen DDR und der Volksrepublik Polen vom 6. Juli 1950 wurde diese Grenzziehung von der DDR und durch den in Warschau geschlossenen Vertrag vom 7. Dezember 1970 von der Bundesrepublik Deutschland anerkannt.
Auf die deutsche Besatzung während des Zweiten Weltkrieges folgte die von der sowjetischen Besatzung aufoktroyierte kommunistische Diktatur. Polen wurde dem Einflussbereich der Sowjetunion zugeschlagen und wurde als Volksrepublik Polen Teil des Warschauer Pakts. Die Marionettenregierung bestand während des Stalinismus aus dem Triumvirat Jakub Berman, Hilary Minc und Bolesław Bierut. Ab 1956 kam es nach Aufständen zu einer Entstalinisierung unter dem Vorsitzenden der kommunistischen Partei Władysław Gomułka. Gomułka folgte 1970 Edward Gierek und 1980 Stanisław Kania, bis 1981 die Junta Jaruzelskis die Macht ergriff. Polen wurde bis 1989 in den Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe und den Warschauer Pakt eingebunden. Durch mehrere Aufstände äußerte die polnische Bevölkerung immer wieder ihren Unmut gegenüber der sowjetischen Besatzung, beispielsweise im Posener Aufstand 1956, den März-Unruhen 1968, dem Danziger Aufstand 1970, dem Volksaufstand in Radom und Ursus bei Warschau 1976. 1956 zeigten die Polen in sehr hohem Maße ihre Solidarität mit den Ungarn, deren Erhebung gegen die sowjetische Fremdherrschaft blutig niedergeschlagen wurde. 1968 beteiligte sich die Truppen der Volksrepublik Polen unter General Wojciech Jaruzelski an der militärischen Niederschlagung des Prager Frühlings.
Erst die Gründung der Gewerkschaft Solidarność nach dem ersten Papstbesuch Johannes Paul II. im Jahr 1979 führte schließlich zu einem gesellschaftlich-politischen Umschwung in und zu den revolutionären Ereignissen von 1980 bis 1989, die zuerst in der Verhängung des Kriegsrechts und schließlich in den Runder-Tisch-Gesprächen und den ersten im Ostblock teilweise freien Wahlen am 4. und 18. Juni 1989 mündeten. An deren Ende wurden der sogenannte Ostblock und anschließend auch die Sowjetunion aufgelöst und das kommunistische Regime durch eine demokratische Regierungsform ersetzt. Die Rolle Lech Wałęsas in der Solidarność-Gewerkschaft wird hierbei kontrovers diskutiert.

Bolesław Bierut

Jakub Berman

Hilary Minc

Władysław Gomułka

Edward Gierek

Wojciech Jaruzelski

Czesław Kiszczak

Johannes Paul II.

Jerzy Popiełuszko
Dritte Republik

Wirtschaftlichen Aufschwung III RP

Trauer nach Absturz 10. April 2010
Bei den teilweise freien Parlamentswahlen vom 4. und 18. Juni 1989 gewann das Bürgerkomitee Solidarność, die politische Organisation der Gewerkschaft Solidarność, sämtliche 161 von 460 frei gewählten Sitzen im Sejm und 99 von 100 Sitzen im wiedereingeführten Senat. Tadeusz Mazowiecki wurde zum ersten Ministerpräsidenten der Dritten Republik Polens sowie zum ersten Regierungschef der Staaten des Warschauer Pakts gewählt, der zum Zeitpunkt seiner Wahl nicht Mitglied der kommunistischen Partei war. Am 29. Dezember 1989 wurde die Verfassung geändert. Die Bestimmungen über die Allianz mit der Sowjetunion und den Ostblockstaaten und die Führungsrolle der kommunistischen Partei wurden gestrichen und der frühere Staatsname „Rzeczpospolita Polska“ (Republik Polen) mit dem alten Wappen wiedereingeführt. 1991 endete die Mitgliedschaft im Warschauer Pakt durch die Auflösung des Militärbündnisses.
Die Planwirtschaft wurde in eine Marktwirtschaft umgewandelt. Gemäß dem umstrittenen Balcerowicz-Plan wurden zahlreiche Staatsunternehmen in kurzer Zeit privatisiert, wobei sehr viele Arbeitnehmer ihre Arbeitsplätze verloren.[56] Im Dezember 1990 wurde der ehemalige Solidarność-Vorsitzende Lech Wałęsa in einer Volkswahl zum Staatspräsidenten gewählt. Unter Wałęsa kam es zu zahlreichen Regierungswechseln. Insbesondere der Sturz der Regierung Jan Olszewski 1992 wird in Polen kontrovers diskutiert, da Wałęsa augenscheinlich hier versucht hat, die Veröffentlichung einer Liste mit Geheimdienstmitarbeiter unter den polnischen Spitzenpolitikern zu vereiteln, auf der er sich selbst befand.
Das Vertrauen der Polen zu Wałęsa sank und im Dezember 1995 verlor er die Präsidentschaftswahl gegen den Herausforderer Aleksander Kwaśniewski, dem ehemalige kommunistische Jugendminister Aleksander Kwaśniewski in den 1980er Jahren. Während Kwaśniewskis Amtszeit trat Polen 1999 der NATO und 2004 der Europäischen Union bei. Am 2. April 1997 wurde von Sejm und Senat eine neue Verfassung verabschiedet und am 25. Mai 1997 per Volksabstimmung, an dem allerdings weniger als 50 % der Abstimmungsberechtigten teilnahmen, angenommen. Sie trat am 17. Oktober 1997 in Kraft. Am 1. Mai 2004 wurde Polen zusammen mit neun weiteren Staaten Mitglied der Europäischen Union. Polen ist unter den mittlerweile 13 neuen Mitgliedstaaten das bevölkerungsreichste und flächenmäßig größte Land. Während des Konfliktes um die Präsidentschaftswahlen im Nachbarstaat Ukraine im November und Dezember 2004 engagierte sich der polnische Präsident Aleksander Kwaśniewski als Vermittler zwischen den Konfliktparteien, während weite Teile der polnische Öffentlichkeit und viele Medien in besonders hohem Ausmaß Solidarität mit der Ukraine und ihrem neuen Präsidenten Wiktor Juschtschenko übten.
Die Parlamentswahlen des Jahres 2005 führten zu einem Politikwechsel in Polen. Der bis dahin regierende SLD wurde durch ein konservatives Bündnis abgewählt. Wahlsieger der Sejm- und Senatswahlen wurde die nationalkonservative PiS von Jarosław Kaczyński, vor der liberalkonservativen PO. Lech Kaczyński, der Zwillingsbruder von Jarosław, gewann anschließend im Oktober 2005 die Präsidentschaftswahlen. Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen am 21. Oktober 2007 verlor die PiS ihre Position als stärkste Partei.
Von November 2007 bis 2015 bildeten die liberalkonservative PO und ihr Koalitionspartner, die Bauernpartei PSL, die Regierung. Zunächst unter Ministerpräsident Donald Tusk, und ab 2014 eine unter Ewa Kopacz.
Am 10. April 2010 stürzte eine polnische Regierungsmaschine mit 96 Insassen bei Smolensk ab. Unter den Todesopfern waren Polens Staatspräsident Lech Kaczyński und seine Ehefrau Maria, zahlreiche Abgeordnete des Parlaments, Regierungsmitglieder, hochrangige Offiziere, Kirchenvertreter, leitende Vertreter von Zentralbehörden sowie Vertreter von Verbänden der Opferangehörigen des Massakers von Katyn. Der Grund für den Absturz ist bis heute unklar und wird weiterhin untersucht.
Nach der Präsidentschaftswahl im Mai 2015 löste Andrzej Duda als Staatspräsident den bisherigen Amtsinhaber Bronisław Komorowski ab. Die Parlamentswahl im Oktober 2015 brachte einen Erdrutschsieg für die nationalkonservative PiS, die mit 37,6 % und 235 von 460 Abgeordneten die erste Alleinregierung in Polen seit 1989 bilden konnte.

Lech Wałęsa

Aleksander Kwaśniewski

Maria & Lech Kaczyński

Bronisław Komorowski

Jan Olszewski

Waldemar Pawlak

Donald Tusk

Beata Szydło
Politik
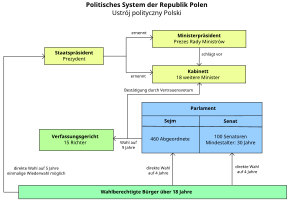
Politisches System Polens
Die Republik Polen ist eine parlamentarische Demokratie. Das derzeit gültige Staatsorganisationsrecht wird vor allem in der Verfassung von 1997 kodifiziert. Im europäischen Vergleich enthält das polnische Regierungssystem zahlreiche Elemente der direkten Demokratie.
Verfassung

Verfassungsverabschiedung 3. Mai 1791
Die erste moderne polnische Verfassung verabschiedete der Große Sejm am 3. Mai 1791. Die derzeit gültige Verfassung wurde am 2. April 1997 von der Nationalversammlung angenommen und in einem Referendum am 25. Mai 1997 von den wahlberechtigten Polen beschlossen. Zwar votierten 53,45 % der Referendumsbeteiligten für die Verfassung, die Beteiligung lag jedoch nur bei 42,86 %. Damit stimmte nur ca. jeder fünfte Referendumsberechtigte für die Verfassung. Die Verfassung trat am 17. Oktober 1997 in Kraft. Sie enthält 243 Artikel und ist damit bedeutend länger als die Verfassungen der Bundesrepublik oder der USA.
Legislative
Das polnische Parlament gehört zu den ältesten Parlamenten der Welt, das – in verschiedenen Formen als Dreikammerparlament und mit Unterbrechungen – seit 1493 existiert. Das Parlament besteht aus zwei Kammern, Sejm und Senat. Der Sejm hat, zusammen mit dem Senat, die Legislative inne. Die im Parlament vertretenen politischen Parteien gruppieren sich als Fraktionen in eine Regierung und die Opposition. Die Sejm-Abgeordneten und Senatoren kommen zu besonderen Anläßen in der Nationalversammlung zusammen.
- Sejm

Plenarsaal des Sejm
Der Sejm setzt sich aus 460 Abgeordneten zusammen. Er beschließt über seine Geschäftsordnung. Der Sejm wird von dem Sejm-Marschall geleitet. Der Sejm-Marschall ist formal nach dem Staatsoberhaupt das zweithöchste politische Amt in der Republik Polen. Der Sejm hat seinen Sitz im Warschauer Regierungsviertel. Die Abgeordneten werden für eine vierjährige Legislaturperiode nach dem Verhältniswahlrecht in allgemeiner und geheimer Wahl gewählt. Es gilt eine 5%-Hürde für Parteien und eine 8%-Hürde für Wahlbündnisse. Die Sitze im Sejm werden nach dem D’Hondt-Verfahren verteilt. Überhangmandate gibt es nach dem polnischen Wahlrecht nicht. Zur Gründung einer Fraktion im Sejm sind fünfzehn Abgeordnete notwendig. Der Sejm beruft (Untersuchungs)Ausschüsse ein. 2017 gab es im Sejm 25 Ausschüsse. Abgeordnete genießen Immunität.
- Senat

Plenarsaal des Senats
Der Senat setzt sich aus 100 Abgeordneten zusammen. Er beschließt über seine Geschäftsordnung. Der Senat wird von dem Senat-Marschall geleitet. Der Senats-Marschall ist formal nach dem Staatsoberhaupt und dem Sejm-Marschal das dritthöchste politische Amt in der Republik Polen. Der Senat hat seinen Sitz im Warschauer Regierungsviertel. Die Senatoren werden für eine vierjährige Legislaturperiode nach dem Mehrwahlrecht in allgemeiner und geheimer Wahl in hundert Wahlkreisen gewählt. Der Sejm beruft (Untersuchungs)-Ausschüsse ein. Derzeit gibt es im Sejm 14 Ausschüsse. Senatoren genießen Immunität.
- Gesetzgebungsverfahren
Das Gesetzesinitiativrecht steht dem Präsidenten, der Regierung, dem Senat, einer Gruppe von mindestens 15 Abgeordneten oder den Bürgern (Gesetzesinitiative muss von 100.000 Bürgern unterschrieben werden) zu. Der Gesetzesentwurf ist an den Sejm-Marschall zu leiten. Der Sejm-Marschall organisiert drei Lesungen und Diskussionen im Sejm. Ein vom Sejm angenommenes Gesetz wird an den Senat weitergeleitet. Ein Senat-Veto kann von dem Sejm überstimmt werden, wenn mindestens die Hälfte der gesetzlichen Abgeordnetenzahl an der Abstimmung teilnimmt. Ein vom Parlament beschlossener Gesetzentwurf wird an den Präsidenten gesandt, der es unterzeichnen, an den Sejm zurücksenden (vetieren) oder zur Prüfung auf Verfassungsmäßigkeit an den Verfassungsgerichtshof weitergeben kann. Ein Veto des Präsidenten kann vom Sejm mit einer Dreifünftel der abgegebenen Stimmen im Sejm zurückgewiesen werden, wenn mindestens die Hälfte der gesetzlichen Abgeordnetenzahl an der Abstimmung teilnimmt. Angenommene Gesetze sind im Gesetzesblatt der Republik Polen zu veröffentlichen.
- Direkte Demokratie
Die polnische Verfassung sieht Referenden auf nationaler und lokaler Ebene vor. Referenden auf nationaler Ebene können initiieren:
- der Sejm
- der Senat
- die Regierung
- die Bürger (hierfür sind 500.000 Unterschriften notwendig)
- der Präsident
Referenden auf nationaler Ebene können in allen Angelegenheiten, die nationale Belange betreffen, abgehalten werden mit Ausnahme von Regelungen in Steuersachen, Verteidigungssachen und Amnestiefragen. Referendumsergebnisse sind bindend, wenn mindestens die Hälfte der Referendumsberechtigten an der Abstimmung teilnimmt. Das Referendum zur Annahme der derzeit gültigen Verfassung hat dieses Kriterium nicht erfüllt, da nur ca. 42 % der Referendumsberechtigten an der Abstimmung teilnahmen.
- Rechtssystem
In Polen besteht ein kontinentaleuropäisches kodifiziertes Rechtssystem mit großen Kodizes in den Hauptrechtsgebieten, u. a. Zivilgesetzbuch, Arbeitsgesetzbuch, Strafgesetzbuch.
Exekutive
Organe der Exekutive sind der Staatspräsident, der zugleich Staatsoberhaupt ist, und der Ministerrat, der vom Premierminister angeführt wird. Die Verfassung vom Juli 1997 grenzt die Kompetenzen zwischen Präsident und Ministerrat nicht hinreichend scharf ab. Insbesondere in den Bereichen Außen- und Verteidigungspolitik kommt es zu Überschneidungen.
- Präsident

Präsidentenpalast

Präsidentenwohnsitz
Der Präsident wird alle fünf Jahre vom Volk direkt gewählt. Erhält im ersten Wahlgang kein Kandidat mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten statt, die die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnten. Eine einmalige Wiederwahl ist möglich. Die Präsidentschaftswahl am 24. Mai 2015 konnte Andrzej Duda für sich entscheiden, welcher von der Partei Recht und Gerechtigkeit, als Kandidat aufgestellt wurde. Er wurde am 6. August 2015 vereidigt.
- Ministerrat

Kanzlei des Ministerpräsidenten
Der Premierminister sowie alle anderen Mitglieder des Ministerrats werden vom Präsidenten ernannt. Der Premierminister wird nach einem Exposé vom Sejm durch ein Vertrauensvotum bestätigt, in dem ihr/ihm mehr als die Hälfte der abstimmenden Abgeordneten das Vertrauen aussprechen muss bei einem Quorum von mindestens der Hälfte der gesetzlichen Abgeordnetenzahl. Die vom Sejm bestätigte Ministerratsmitglieder werden vom Präsidenten vereidigt. Der Ministerrat setzt sich aus dem Premierminister, den Vize-Premierministern, den Ministern und den Komiteevorsitzenden zusammen.
Judikative

Palast der Adelsrepublik, ab 1765 und 1919–1939 erster Sitz des Obersten Gerichts

Oberstes Gericht

Verfassungsgerichtshof

Oberstes Verwaltungsgericht
Die Gerichtsbarkeit in Polen teilt sich in eine ordentliche und eine Verwaltungsgerichtsbarkeit. Die Gerichtsbarkeiten verfügen über jeweils vier bzw. drei Instanzen und einen dreistufigen Instanzenzug. Das oberste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit ist das Oberste Gericht und in der Verwaltungsgerichtsbarkeit das Oberste Verwaltungsgericht, beide mit Sitz in Warschau. Ebenfalls in Warschau befinden sich der Verfassungsgerichtshof, der in verfassungsrechtlichen Fragen Recht spricht, und der Staatsgerichtshof.
Instanzen der ordentliche Gerichtsbarkeit:
- Rejongerichte
- Kreisgerichte
- Appellationsgerichte
- Oberstes Gericht
Instanzen der Verwaltungsgerichtsbarkeit:
- Verwaltungsgericht
- Woiwodschaftsverwaltungsgericht
- Oberstes Verwaltungsgericht
Eine separate Arbeits-, Sozial- und Finanzgerichtsbarkeit gibt es in Polen nicht. Rechtsstreitigkeiten im Arbeitsrecht werden vor den ordentlichen Gerichten, Rechtstreitigkeiten im Sozial- und Finanzrecht vor den Verwaltungsgerichten ausgetragen. Es besteht zudem eine separate Militärgerichtsbarkeit. Private Schiedsgerichte sind zulässig. So hat zum Beispiel die deutsch-polnische Industrie- und Handelskammer ein Schiedsgericht in Warschau.
Parteien
Während im 16. und 17. Jahrhundert Zusammenschlüsse von Abgeordneten im polnischen Sejm spontan waren und meist nur die Wahl eines Königs oder die Durchsetzung von kurzfristigen Interessen im Rahmen einer Konföderation dienten, etablierten sich die ersten dauerhaften Parteien am Anfang des 18. Jahrhunderts, insbesondere anfangs die Familia um die Magnatenfamilien der Czartoryski und Poniatowski sowie die mit dieser konkurrierenden Hetmanen-Partei um die Magnatenfamilien der Branicki und Potocki sowie die Kamaryla Mniszcha um Jerzy August Mniszech und in der zweiten Jahrhunderthälfte die Parteien der Jakubiner, der Patrioten und die Verfassungs-Partei, die sich im Zuge der Reformen des Großen Sejms bildeten. Moderne Parteien entstanden während der Teilungszeit im 19. Jahrhundert in den zu Preußen, Österreich und Russland gehörenden Landesteilen. Entsprechend groß war die Anzahl der Parteien am Anfang der Zweiten Polnischen Republik nach der Erlangung der Unabhängigkeit. Nach der sowjetischen Besetzung 1939/1944 wurde nach russischem Vorbild ein Einparteiensystem eingeführt, wobei es noch zwei Scheinparteien gab, die keine politische Rolle spielten. Nach 1989 entstanden aus der Solidarność-Bewegung und den Postkommunisten zahlreiche Kleinparteien. Nach der Jahrtausendwende vereinigten sich einige dieser Kleinstparteien zu den derzeit führenden Parteien im polnischen Sejm. 2017 waren in Polen 85 politische Parteien registriert. Die Verfassung sowie das Parteiengesetz regeln die Rechte und Pflichten von Parteien.
- Parlamentsparteien
| Partei | Sejm | Senat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Sitze | Kandi- daten | Sitze | |||||||
| | Recht und Gerechtigkeit | 5.711.687 | 37,58 | 235 | 98 | 61 | |||||
Bürgerplattform | 3.611.474 | 24,09 | 138 | 83 | 34 | ||||||
Kukiz’15 | 1.339.094 | 8,81 | 42 | 9 | — | ||||||
Nowoczesna | 1.155.370 | 7,60 | 28 | 16 | — | ||||||
Bauernpartei | 779.875 | 5,13 | 16 | 58 | 1 | ||||||
Deutsche Minderheit | 27.530 | 0,18 | 1 | 3 | — | ||||||
| Quelle: Państwowa Komisja Wyborcza (PKW; Nationale Wahlkommission), 27. Oktober 2015[57] | |||||||||||
- Spitzenpolitiker
Einer der Kritikpunkte an der Verfassung von 1997 ist, dass die von ihr vorgegebene Rangordnung der Politiker nicht den tatsächlichen politischen Machtverhältnissen entspricht. Formell sind der Staatspräsident und danach folgend der Sejm-Marschall sowie der Senat-Marschall die wichtigsten Politiker in Polen. De facto bestimmt jedoch der Premierminister die laufende Politik, der in der formellen Rangordnung erst an vierter Stelle steht. Nicht ohne politischen Einfluss ist zudem der Vorsitzende der Regierungspartei bzw. -koalition, da die Parlamentsmehrheit den Premierminister jederzeit abberufen kann.

Präsident Andrzej Duda

Sejm-Marschall Marek Kuchciński

Senat-Marschall Stanisław Karczewski

Premierminister Mateusz Morawiecki
Koalitionsvorsitzender Jarosław Kaczyński
Außenpolitik

2017 zog die EU-Behörde Frontex vom Rondo 1-B in den Ostturm der Warsaw Spire in Warschau um
Die Außenpolitik der Dritten Republik wird von der Geschichte und der geopolitischen Lage Polens bestimmt. Verantwortlich zeichnet der Außenminister, derzeit Jacek Czaputowicz, unterstützt vom Präsidenten.
Die polnische Außenpolitik ist aufgrund der langen Erfahrung von Fremdbestimmung auf möglichst uneingeschränkte Souveränität ausgerichtet. In der EU sucht Polen ein hohes Maß an Eigenständigkeit.
Polen ist Gründungsmitglied zahlreicher internationaler Organisationen, unter anderem: Vereinte Nationen, Mitteleuropäisches Freihandelsabkommen (bis einschließlich 2004), Ostseerat, Visegrád-Gruppe, Weimarer Dreieck oder Kaliningrad Dreieck. Polen ist weiterhin Mitglied von: Europäische Union, NATO, Welthandelsorganisation, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Europäischer Wirtschaftsraum, Internationale Energieagentur, Europarat, Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Internationale Atomenergie-Organisation, Europäische Weltraumorganisation, Europäische Südsternwarte, G6 der Europäischen Union, Gemeinschaft der Demokratien, Zentraleuropäische Initiative, Drei-Meere-Initiative, Ostsee-Naturschutzorganisation sowie aller Unterorganisationen der UNO. Polen hat Beobachterstatus bei folgenden Organisationen: Arktischer Rat und Internationale Organisation der französischsprachigen Länder. Im Ramen der Europäischen Untion ist Polen Mitglied im Schengener Abkommen und ist Anwärter für den Beitritt zur Eurozone. Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache – Frontex hat ihren Sitz in Polen.
Als wichtigsten Verbündeten sehen die Polen die Vereinigten Staaten. Auf polnischem Staatsgebiet sind seit 2016 US-Truppen stationiert.[58]
Im Osten sieht sich Polen Litauen, Weißrussland und der Ukraine verbunden, mit denen es jahrhundertelang die polnisch-litauische Adelsrepublik gebildet hat. Polen sieht sich als Anwalt der Ukraine in deren Beziehungen zu NATO und EU.
Bereits die Adelsrepublik pflegte Polen diplomatische Beziehungen zu Persien und dem Osmanischen Reich, das im Gegenzug nie die Teilungen Polens anerkannt hat und bei jeder internationalen Konferenz nach dem polnischen Gesandten fragte.
Gute Beziehungen unterhielt die Adelsrepublik auch mit Frankreich und dem Kirchenstaat.
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte die Zweite Republik ein gutes Verhältnis zu Großbritannien, das im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs für Polen eine Garantie abgab.
Die Beziehungen zu Deutschland und Russland sind dagegen seit den Teilungen Polens – mit Ausnahme der Zeit der Polenbegeisterung (z. B. Hambacher Fest) des Vormärzes – und insbesondere aufgrund des Zweiten Weltkriegs sowie der folgenden Abhängigkeit von der Sowjetunion belastet. Interessanterweise sind dabei die Beziehungen zu Österreich, das ebenfalls an den Teilungen Polens und dem Überfall auf Polen teilnahm, weitaus entspannter. Die Beziehungen zu der Schweiz, die Auslandspolen während der Teilungszeit unterstützte, sind dagegen freundschaftlich.
Polen verbindet mit Ungarn ein besonders freundschaftliches Verhältnis, das bis ins Hochmittelalter zurückreicht, als die beiden Königreiche dreimal in Personalunion regiert wurden. Polen und Ungarn arbeiten zusammen mit Tschechien und der Slowakei eng in der Visegrád-Gruppe zusammen.
Auch zu den anderen Staaten der Drei-Meere-Initiative bestehen traditionell gute Beziehungen.
Militär

Übung bei Drawsko Pomorskie

PT91 Twardy
Gemäß dem Ranking von Global Firepower (2016)[59] besitzt Polen die 18. stärkste Armee weltweit und die 5. stärkste in Europa. Der Wehretat betrug 2016 9,7 Mrd. USD bzw. ca. 2 % des polnischen BIP, womit Polen eines der wenigen Länder ist, dass die diesbezüglichen NATO-Vorgaben erfüllt. Derzeit modernisiert Polen seine Streitkräfte. Im Zuge der Ukrainekrise hat Polen diesen Prozess intensiviert.[60] Der Wehretat soll auf 2,5 % des polnischen BIP und die Anzahl der Soldaten auf 200.000 aufgestockt werden. Polen hat angekündigt, bis 2022 mehr als 30 Milliarden Euro für die Beschaffung neuer Waffensysteme auszugeben.
Der Präsident ist oberster Befehlshaber über die polnischen Streitkräfte. Unmittelbar untersteht das Militär jedoch dem Verteidigungsminister und besteht aus den Luftstreitkräften, der Marine, den Landstreitkräften, den Spezialeinheiten und der Territorialverteidigung.
- Historische Entwicklung
In den Zeiten der Adelsrepublik bestand die Wehrpflicht nur für die Szlachta zum Verteidigungskrieg. Bekannt sind in der Geschichte besonders die polnische Hussaria und die Ulanen, die sich in den Schweden- und Türkenkriegen auszeichneten.
Eine der Reformen des Großen Sejm Ende des 18. Jahrhunderts war die Einführung eines stehenden Heers von 100.000 Mann, zu dessen Organisation es jedoch aufgrund der zweiten und dritten polnischen Teilung nicht mehr kam.
Während der napoleonischen Kriege entstanden polnische Legionen in Italien und Frankreich. Das Großherzogtum stellte einen großen Teil der Soldaten, die an Napoleons Russlandfeldzug 1812 teilnahmen.
Die moderne polnische Armee entstand während des Ersten Weltkriegs aus der Polnischen Wehrmacht und den Polnische Legionen sowie später in der Zweiten Republik im Zuge des Polnisch-Sowjetischer Kriegs mit anfangs über 800.000 Soldaten.
In der Volksrepublik unterstanden die polnischen Streitkräfte im Rahmen des Warschauer Paktes der sowjetischen Führung.
Nach 1989 wurde das Militär reformiert, die Zahl der Soldaten von über 500.000 auf 150.000 Soldaten (plus 450.000 Reservesoldaten) reduziert und die Ausrüstung modernisiert. Die polnischen Streitkräfte verfügen über neuestes Waffenmaterial, wie zum Beispiel die amerikanischen F-16, moderne israelische Panzerabwehrlenkwaffen und die finnischen Patria AMV 8×8. Daneben wurden die polnischen Waffenproduzenten durch Offset-Investitionen der Amerikaner auf den neuesten Stand gebracht und exportieren erfolgreich schweres Kriegsgerät weltweit. Eine neue Eliteeinheit, die Einheit GROM, wurde in den 1990er Jahren eingeführt.
Im März 1999 trat Polen der NATO bei, nachdem es seit 1994 in deren Programm „Partnerschaft für den Frieden“ mitgearbeitet hatte.

F-16 Jastrząb

ORP Generał Pułaski
Am 13. November 2006 wurde mit Deutschland, Lettland, Litauen und der Slowakei ein Abkommen zur Bildung einer gemeinsamen EU-Einsatztruppe unterzeichnet. Polen übernahm dabei das Oberkommando und stellte etwa 1500 Soldaten zur Verfügung.
Bis 2008 bestand in Polen Wehrpflicht für Männer.
Polnische Militäreinheiten waren 2010 im Ausland in Afghanistan (2600 Soldaten), im Kosovo (320), in Bosnien und Herzegowina (204) und im Irak (20) im Einsatz.
- Luftstreitkräfte
Die Luftstreitkräfte verfügen über knapp 200 Kampfflugzeuge, davon 48 Mehrzweck-Kampfflugzeug F-16, 36 Mehrzweck-Kampfflugzeug MiG-29 und 48 Bomber Suchoi Su-22 sowie etwa 250 Kampfhubschrauber. Es ist geplant, ca. 50 weitere Kampfhubschrauber zu erwerben.
- Marine
Die polnische Marine verfügt über zwei Fregatten, eine Korvette, drei Schnellboote, fünf U-Boote, mehrere Schul- und Hilfsschiffe sowie ein Flugzeug und fünf Hubschrauber. Es ist geplant, die U-Boot-Flotte auszubauen.
- Landstreitkräfte

Spezialeinheiten

Vereidigung WOT-Einheit
Polen hat derzeit etwa 120.000 Soldaten und 500.000 Reservisten. Das Rückgrat der Landstreitkräfte bilden 1065 Kampfpanzer, davon 249 Leopard 2, 232 PT-91 und 528 T-72, sowie mehrere Tausend Schützenpanzer und andere Panzerfahrzeuge, darunter insbesondere 1268 BMP-1, 690 KTO Rosomak, 237 BRDM-2, 28 Bergepanzer 2, 74 WPT Mors, 90 TRI, 5 KTO Ryś, 70 D-44, 27 9P148 „Malyutka”, 217 HMMWV, 75 WR-40 Langusta, 75 BM-21, 120 AHS Krab, 111 DANA, 342 2S1, 20 ZSU-23-4MP Biała, 64 9K33 Osa sowie ca. 200 Kampfhubschrauber.
- Spezialeinheiten
Die polnischen Spezialeinheiten verfügen über 2250 Elitesoldaten. Die bekannteste Spezialeinheit ist die GROM.
- Territorialverteidigung
Die Einheiten der Territorialverteidigung (WOT) wurden 2017 als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine eingeführt. Derzeit dienen ca. 8000 Soldaten in dieser Einheit. Geplant ist, die Territorialverteidigung auf 50.000 Soldaten auszubauen.
Verwaltung

Schema der Verwaltungsgliederung

Polnische Woiwodschaften

Schwarz-Woiwodschaft- Rot-Landkreis- Grün-Gemeindegrenzen

Woiwodschaftsamt Masowien

Woiwodschaftsamt Kleinpolen
- Verwaltungsgliederung
Seit dem 1. Januar 1999 ist Polen in 16 Woiwodschaften (województwo) eingeteilt, die auf die historischen Regionen Polens Bezug nehmen. Die kleinste Woiwodschaft – Oppeln – ist nur ca. 10.000 Quadratkilometer groß, während die Fläche der größten Woiwodschaft – Masowien – 3,5 mal so groß ist. Auch hinsichtlich der Einwohnerzahl gibt es große Unterschiede. Während die Woiwodschaft Masowien fast 5,5 Millionen Einwohner hat, leben in der Woiwodschaft Oppeln weniger als eine Million Menschen. Eine Reform der Woiwodschaften wird diskutiert, insbesondere wird erwogen, eine Woiwodschaft Mittelpommern aus den Randgebieten der Woiwodschaften Pommern und Westpommern zu bilden sowie die Metropolregion Warschau aus der Woiwodschaft Masowien auszugliedern. Im Gespräch ist auch die Aufteilung der Woiwodschaft Oppeln zwischen den Woiwodschaften Niederschliesien und Schlesien.
Polen ist ein Zentralstaat. Die Autonomie der Woiwodschaften ist beschränkt. Insbesondere besitzen die Woiwodschaften nur eine sehr begrenzte Rechtsetzungskompetenz.
Jede Woiwodschaft besitzt als Selbstverwaltungsorgane eine eigene Volksvertretung – Woiwodschaftssejmik (sejmik województwa) und einen von ihnen gewählten Woiwodschaftsvorstand (zarząd województwa) unter dem Woiwodschaftsmarschall (marszałek województwa) als Vorsitzendem. Der Woiwode (wojewoda) ist hingegen ein Vertreter der Zentralregierung in Warschau und für Kontrolle der Selbstverwaltung der Woiwodschaften, Landkreise (powiat) und Gemeinden (gmina) zuständig.
Die Woiwodschaften gliedern sich in Landkreise und diese wiederum in Gemeinden. Es wird zwischen Landgemeinden, Stadtgemeinden und gemischten Stadt-Land-Gemeinden unterschieden. Größere Städte haben in der Regel sowohl den Status einer Gemeinde wie auch eines Landkreises, sind also kreisfrei. Größere Gemeinden gliedern sich wiederum in Schulzämter, Viertel, Siedlungen oder Kolonien. 2016 gab es in Polen sechzehn Woiwodschaften, 380 Landkreise, und fast 2500 Gemeinden.
| Wappen | Flagge | Deutscher Name | Polnischer Name | Hauptstadt / Hauptstädte | Einwohnerzahl 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Woiwodschaft Ermland-Masuren | Województwo warmińsko-mazurskie | Allenstein | 1.436.367 | ||
| Woiwodschaft Großpolen | Województwo wielkopolskie | Posen | 3.481.625 | ||
| Woiwodschaft Heiligkreuz | Województwo świętokrzyskie | Kielce | 1.252.900 | ||
| Woiwodschaft Karpatenvorland | Województwo podkarpackie | Rzeszów | 2.127.656 | ||
| Woiwodschaft Kleinpolen | Województwo małopolskie | Krakau | 3.382.260 | ||
| Woiwodschaft Kujawien-Pommern | Województwo kujawsko-pomorskie | Thorn und Bromberg | 2.083.927 | ||
| Woiwodschaft Lebus | Województwo lubuskie | Landsberg an der Warthe und Grünberg | 1.017.376 | ||
| Woiwodschaft Łódź | Województwo łódzkie | Lodsch | 2.485.323 | ||
| Woiwodschaft Lublin | Województwo lubelskie | Lublin | 2.133.340 | ||
| Woiwodschaft Masowien | Województwo mazowieckie | Warschau | 5.365.898 | ||
| Woiwodschaft Niederschlesien | Województwo dolnośląskie | Breslau | 2.903.710 | ||
| Woiwodschaft Opole | Województwo opolskie | Oppeln | 993.036 | ||
| Woiwodschaft Podlachien | Województwo podlaskie | Białystok | 1.186.625 | ||
| Woiwodschaft Pommern | Województwo pomorskie | Danzig | 2.315.611 | ||
| Woiwodschaft Schlesien | Województwo śląskie | Kattowitz | 4.559.164 | ||
| Woiwodschaft Westpommern | Województwo zachodniopomorskie | Stettin | 1.708.174 |
Städte

Die größten Städte in Polen

Alle Städte in Polen
In der Antike wurden die Ortschaften Calisia und Turso auf dem heutigen Gebiet Polens erwähnt. Es wird vermutet, dass diese Orte mit den heutigen Städten Kalisz und Elbląg gleichzusetzen sind. Die Pfahlbausiedlung Biskupin geht auf das 8. Jahrhundert vor Christus zurück. Slawische Siedlungen entstanden um das 6. Jahrhundert nach Christus vor allem auf leicht zu schützenden See- und Flußinseln um Holzburgen der jeweiligen Stammesfürsten. Vielen Ortschaften wurde ab dem 13. Jahrhundert ein Stadtrecht nach Magdeburger, Lübecker oder Kulmer Vorbild verliehen. Im Hochmittelalter traten viele Städte der Hanse oder anderen Städtebünden bei. Nachdem in der Adelsrepublik das potitische Gewicht sich von den Städten zum Adel verschob, verloren viele Städte im 18. Jahrhundert an Bedeutung. Mit den Reformen des Großen Sejm Ende des 18. Jahrhunderts gewann das Bürgertum gegenüber dem Adel wieder an Bedeutung. Die Reformen waren jedoch aufgrund der beiden letzten polnischen Teilungen nicht von Dauer. Die modernen polnischen Städte entstanden im Zuge der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts.
Nach dem Hauptstatistikamt gab es im Jahr 2016 919 Städte in Polen. Etwa 40 Städte in Polen haben eine Einwohnerzahl von mehr als 100.000 und gelten damit als Großstädte. Die kleinste Stadt Wyśmierzyce hatte 921 Einwohner und Warschau als die bevölkerungsreichste Stadt fast 2000-mal mehr. Die flächenäßig kleinste Stadt war Stawiszyn mit 0,99 km² und die größte Fläche hatte Warschau mit 517,24 km².[61] Die gerinste Bevölkerungsdichte hatte Krynica Morska mit 12 Personen/km² und die höchste Legionowo mit 3996 Personen/km².[61]
Die größten Städte Polens sind Warschau, Krakau, Łódź, Breslau, Posen, Danzig, Stettin, Bydgoszcz und Lublin. Die größten Agglomerationen sind der Warschauer Großraum, die Regionen um Kattowitz, Łódź, Krakau und die sogenannte „Dreistadt“ mit Danzig, Sopot und Gdingen. 60,5 % der polnischen Bevölkerung leben in Städten, womit Polen zu den weniger stark urbanisierten Ländern in Europa zählt.[62]
Wirtschaft und Infrastruktur

Warsaw Financial Center

Warschauer Wertpapierbörse
Die Wirtschaft Polens stand 2016 sowohl gemessen am Bruttoinlandsprodukt (467.647 Mio. USD[63]) als auch bezüglich der Kaufkraftparität (1.054.319 Mio. USD[63]) an 24. Stelle in der Welt.
Seit dem Ende des Sozialismus hat sich die polnische Wirtschaft vergleichsweise gut entwickeln können. Polen konnte in den letzten Jahren ein durchgängig positives Wirtschaftswachstum verzeichnen. Polen war das einzige europäische Land, das infolge der globalen Krise (2008) keine Rezession erfahren musste. Seit 2013 hat sich die Wirtschaft weiter erholt, getragen von inländischer Nachfrage, insbesondere Investitionen und Konsum. 2017 stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorjahr um 4,6 Prozent. Das Wachstum wird gefördert durch eine wirtschaftsfreundliche Politik, fiskalpolitische Stabilität, ein flexibles Arbeitsrecht, durch die konsequente Nutzung von EU-Fördermitteln für den Ausbau der Infrastruktur und nicht zuletzt auch durch umfangreiche ausländische Direktinvestitionen. Im Vergleich mit dem BIP der EU ausgedrückt in Kaufkraftstandards erreichte Polen 2015 einen Indexwert von 69 (EU-28:100) und damit etwa 55 % des deutschen Wertes.[64]
Das Bruttoinlandsprodukt ist regional sehr unterschiedlich verteilt. Die reichsten Woiwodschaften waren 2009 Masowien (133 % des Landesdurchschnitts) und Niederschlesien (114 %) sowie die ärmsten Woiwodschaften Lublin (68 % des Landesdurchschnitts), Karpatenvorland (71 %) und Heiligkreuz (74 %).[65] Die Arbeitslosigkeit betrug im Dezember 2017 ca. 6,6 Prozent, die Zahl der registrierten Arbeitslosen lag bei 1,08 Mio.[66] Im Global Competitiveness Index, der die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes misst, belegt Polen Platz 39 von 137 Ländern (Stand 2017–2018).[67] Im Index für wirtschaftliche Freiheit belegte Polen 2017 Platz 45 von 180 Ländern.[68][69] Polen ist eine weitestgehend offene Volkswirtschaft, die sehr stark vom freien Handel in der Europäischen Union profitiert.
Während die Inflation 2010 2,581 % betrug,[63] herrscht seit Mitte 2014 Deflation in Polen.
In dem Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International lag Polen 2017 von 180 Ländern zusammen mit den Seychellen auf dem 36. Platz.[70]
Staatshaushalt

Staatsschuldenquote
Der Staatshaushalt umfasste 2017 Ausgaben von 375,9 Mrd. PLN, dem standen Einnahmen von 350,5 Mrd. PLN gegenüber. Daraus ergibt sich ein Haushaltsdefizit in Höhe von 25,4 Mrd. PLN.[71]
Die Staatsverschuldung betrug im Dritten Quartal 2017 52 % des BIP und lag deutlich unterhalb der Werte für den EU-Durchschnitt von 82,5 % und der Eurozone von 88,1 %.[72]
Der Anteil der Staatsausgaben (in % des BIP) folgender Bereiche betrug in den letzten Jahren:
Gesundheit – 6,4 %[73] (2013)
Bildung – 5 %[73] (2014)
Militär – 2 %[73] (2016)
Steuern
In Polen werden Steuern auf nationaler und regionaler Ebene erhoben. Die wichtigsten Steuern sind nationale Steuern, insbesondere die Einkommensteuer, Körperschaftssteuer und Umsatzsteuer. Abgesehen von der Umsatzsteuer sind die polnischen Steuersätze im internationalen Vergleich relativ niedrig.
In Polen wird eine lineare Einkommensteuer mit drei Steuersätzen von 0 % (Grundfreibetrag), 18 % und 32 % erhoben. Der polnische Spitzensteuersatz der Einkommensteuer beträgt damit 32 % und ist im internationalen Vergleich relativ niedrig. Unternehmer haben zudem die Möglichkeit, eine linearen Einkommensteuersatz von 19 % zu bezahlen, wenn sie eine vereinfachte Steuererklärung abgeben, in der sie auf die Geltendmachung gewisser Werbungskosten verzichten.
In Polen gibt es keine Gewerbesteuer. Ebenso wird keine Kirchensteuer und kein Solidaritätszuschlag erhoben.
Die Körperschaftssteuer wird auf das Einkommen von Kapitalgesellschaften erhoben. Der Steuersatz beträgt bei kleinen Kapitalgesellschaften 15 % und bei großen Kapitalgesellschaften 19 %.
In Polen gibt es keine Vermögenssteuer. Die Gemeinden erheben jedoch eine Grundsteuer auf in ihnen gelegene Immobilien.
Die Umsatzsteuersätze betragen 0 %, 5 %, 7 %, 8 % und 23 %. Gewisse Umsätze, die nicht der Umsatzsteuer unterliegen, werden mit einer Transaktionssteuer mit Steuersätzen von 0,1 % bis 2 % besteuert.
Polen hat mit den meisten Staaten ein Doppelbesteuerungsabkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Besteuerung von Einkommen abgeschlossen.
Außenhandel
Der Export umfasste im Jahre 2016 183,0 Mrd. Euro und der Import 178,2 Mrd. Euro.[73] Da es ein günstiger Produktionsstandort für ausländische Unternehmen ist, hat es inzwischen eine positive Handelsbilanz. Mit 27,4 % der Exporte und 28,3 % der Importe stellte Deutschland den größten Handelspartner dar. Weitere wichtige Handelspartner sind die EU-Staaten Italien, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Niederlande und Tschechien sowie Russland, Volksrepublik China und die USA.

Außenhandelsentwicklung
| Export (in Prozent) nach | Import (in Prozent) von | ||
|---|---|---|---|
Deutschland | 27,4 | Deutschland | 28,3 |
Vereinigtes Konigreich | 6,6 | China Volksrepublik | 7,9 |
Tschechien | 6,6 | Niederlande | 6,0 |
Frankreich | 5,4 | Russland | 5,8 |
Italien | 4,8 | Italien | 5,3 |
Niederlande | 4,5 | Frankreich | 4,2 |
Schweden | 2,9 | Tschechien | 4,1 |
| sonstige Länder | 41,8 | sonstige Länder | 38,4 |
Arbeitsmarkt
Im September 2017 lag die Arbeitslosenquote nach GUS bei 6,8 %,[75] was knapp eine Mio. Menschen im erwerbsfähigen Alter ausmachte, sowie nach Eurostat bei 4,6 %.[76] Zuvor lag im Oktober 2012 laut polnischem Haupt-Statistikamt die Arbeitslosigkeit bei 12,5 %.[75]
Die Arbeitslosigkeit in Polen ist regional sehr unterschiedlich verteilt. In den Städten Posen und Warschau herrscht praktisch Vollbeschäftigung während in den ländlichen Regionen von Ermland-Masuren die Arbeitslosigkeit im September 2017 hingegen nach GUS bei 11,8 % lag[77]
Im November 2006 erhielten 13,2 Prozent der registrierten Arbeitslosen Arbeitslosengeld. Etwa 12 % der Beschäftigten waren 2013 in der Landwirtschaft beschäftigt, was im Verhältnis zum EU-Durchschnitt (5 %) viel ist. 30,3 % sind in der Industrie und 57,8 % im Dienstleistungssektor tätig.[78] Etwa ein Drittel der Arbeitsplätze finden sich im öffentlichen Dienst.[78]
Energieversorgung
Die Bruttostromerzeugung der polnischen Kraftwerke lag im Jahr 2012 bei ca. 160 TWh.[79] Die elektrische Energieversorgung in Polen basiert weitgehend auf der Verstromung von Stein- und Braunkohle, die im Jahr 2012 zusammen 88,6 % des polnischen Stroms lieferten. Wichtigstes Bergwerksunternehmen ist die staatliche Kompania Węglowa. Gaskraftwerke waren weitgehend unbedeutend, Erneuerbare Energien deckten 8,7 % des Strombedarfs, wobei Biomasse vor der stark wachsenden Windenergie und der Wasserkraft lag. Polen hat reiche Lager and Geothermie, die derzeit verstärkt in Kujawien bei Thorn und in der Bergregion Podhale bei Zakopane genutzt wird. Der Anteil der Kraft-Wärme-Kopplung liegt mit 16,6 % an der Gesamterzeugung auf relativ hohem Niveau.[80] Aufgrund des sehr hohen Anteils konventioneller Energieträger setzen sich polnische Politiker aus Sorge vor möglicherweise hohen Kosten gegen ambitionierte Klimaschutzziele ein.[81] Die polnische Politik setzt auch auf den Kohlestrom, um möglichst unabhängig von Energieimporten zu sein.
Das Land besitzt bisher keine kommerziell betriebenen Kernkraftwerke, betreibt aber mit dem Forschungsreaktor Maria, der am 18. Dezember 1974 kritisch wurde, einen kleinen Versuchsreaktor mit einer thermischen Leistung von 30 MW. Dieser arbeitet gegenwärtig mit nur zwei Drittel der Leistung. Bis 1968 wurde im Südwesten des Landes Uranbergbau betrieben. Die Planung neuer Kernkraftwerke wurde im Juni 2013 ausgesetzt. Begründet wurde der Schritt mit zu hohen Kosten.[82]
Unternehmen
| Logo | Unternehmen | Branche | Sitz | Umsatz (Mio PLN) | Arbeitnehmer |
|---|---|---|---|---|---|
PKN Orlen SA | Rohstoffe | Płock | 79.553 | 4.445 | |
| PGNiG | Rohstoffe | Danzig | 33.196 | 5.168 | |
| PGE SA | Energie | Warschau | 28.092 | 44.317 | |
| PZU SA | Versicherung | Warschau | 22.212 | 36.419 | |
| Grupa Lotos SA | Rohstoffe | Danzig | 20.931 | 33.071 | |
KGHM Polska Miedź SA | Rohstoffe | Lubin | 19.556 | 18.578 | |
Tauron Group SA | Energie | Katowice | 17.646 | 26.710 | |
| Cinkciarz.pl Sp. z o.o. | Kreditinstitut | Zielona Góra | 14.283 | 22.556 | |
| PKO BP | Kreditinstitut | Warschau | 13.544 | 5.303 | |
| Enea SA | Energie | Posen | 11.255 | 23.805 |
Polens Wirtschaft gilt als regionaler Leader in Mittel- und Osteuropa mit 40 % der 500 umsatzstärksten börsennotierten Unternehmen der Region, die ihren Sitz in Polen haben.
Tourismus

Strandurlaub bei Putzig

Wawel-Kathedrale in Krakau

Marienburg in Malbork

Wandern am Meerauge in der Tatra
Der Tourismus ist ein bedeutender Faktor bei den Einnahmen im Dienstleistungssektor. Nach der Weltorganisation für Tourismus ist Polen sechzehnte beliebteste Reiseziel bei internationalen Touristen.[83] Im Jahr 2015 kamen über 16,7 Mio. ausländische Touristen nach Polen, was einen Anstieg von 4,6 % gegenüber dem Vorjahr ausgemacht hat. Der touristische Sektor hat 2015 ein Volumen von fast 10 Mld US-Dollar ausgemacht.[84] Im Jahr 2016 betrug die Anzahl der Einreisen nach Polen 80,5 Mio, wovon ca. 17,5 Mio als touristisch zu werten sind.[85]
Das beliebteste Reiseziel in Polen ist die ehemalige Hauptstadt Krakau, die zahlreiche Architekturdenkmäler und Kunstwerke aus dem polnischen Goldenen Zeitalter der Spätgotik und Renaissance besitzt. Bedeutende touristische Ziele sind auch die Städte Warschau, Breslau, Danzig, Posen, Stettin, Lublin, Thorn und Zakopane. Der Tourismus spielt auch eine wichtige Rolle für die Gemeinden Krynica-Zdrój, Karpacz, Szklarska Poręba, Biecz, Zamość, Sandomierz, Kazimierz Dolny, Tschenstochau, Gnesen, Frombork, Malbork, Gdynia, Sopot, Kołobrzeg, Świnoujście und Międzyzdroje. Viele Städte bieten touristische Dienstleistungen für Familien mit Kindern, so zum Beispiel Breslau mit den Breslauer Zwergen, Warschau, Kielce, Danzig und Stettin.[86][87][88][89] Einige kleinere Orte in Polen sind Mitglied der Vereinigung Cittàslow, die auf einen ausgewogenen Tourismus setzen.[90]
Besuchermagneten sind: das Salzbergwerk Wieliczka, das Museum im Geburtshaus von Fryderyk Chopin in Żelazowa Wola bei Sochaczew, die Gedächtnisstätte des Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, die Küste der Ostsee, die großen Seeplatten in Großpolen, Masuren, Kaschubien und Suwalki sowie die Gebirgszüge der Sudeten und Karpaten, insbesondere die Tatra mit der Hohen Tatra und Westtatra, in der sich der höchste Gipfel Polens Meeraugspitze sowie der bekannte Höhenweg Orla Perć befinden. Beliebte Erfholungsgebiete sind auch die Heiligkreuzberge, Beskiden, Pieninen, Krakau-Tschenstochauer Jura und das Roztocze und die das Stettiner und Frisches Haff.
Der polnische Gebirgsverein PTTK betreibt zirka 200 Schutz- und Berghütten in den polnischen Bergen und hält die 63.000 Kilometer (Fern-)Wanderwege in Stand, von denen der Beskiden-Hauptwanderweg, der Sudeten-Hauptwanderweg, der Pieninenweg und der Weg der polnisch-tschechischen Freundschaft die bekanntesten sind.
Zum Welterbe in Polen zählen fünfzehn Positionen, unter anderem die Altstädte von Krakau, Warschau, Thorn und Zamość.
In Polen gibt es 23 Nationalparks in Polen, die bis auf streng geschützte Naturreservate für Touristen zugänglich sind. Mit drei Millionen Besuchern ist der Tatra-Nationalpark der beliebteste.
Einer immer größeren Beliebtheit erfreut sich auch der Fahrradtourismus in Polen, so zum Beispiel der östliche Radwanderweg Green Velo.[91]
Auf Flüssen und Gewässern gibt es viele Wasserwege für Kajak, Kanu, Segel- und Hausboote, zum Beispiel auf der Pilica[92], der Krutynia oder der Czarna Hańcza.
In den Karpaten und Sudeten gibt es zahlreiche Skigebiete, die meisten in und um Zakopane in der Tatra und Szczyrk in den Schlesischen Beskiden sowie Karpacz in dem Riesengebirge.
Beliebt ist auch Kururlaub in den zahlreichen Kurorten wie Połczyn-Zdrój oder Ciechocinek.
Einer immer größeren Beliebtheit erfreut sich Thermalbäder, die in den letzten Jahren vor allem in der Bergregion Podhale bei Zakopane eröffnet wurden.
In Polen gibt es über hundert erhaltene mittelalterliche Burgen und Schlösser, unter anderem die Adlerhorst-, Dunajec- und Deutschordensburg. Paläste aus der Renaissance und dem Barock findet man vor allem im Osten Polens und in Warschau. Gutshöfe des polnischen Kleinadels sind dagegen über das ganze Land verstreut.
Verkehr
Polen ist ein wichtiges Transitland von Nordeuropa nach Südeuropa und von Westeuropa nach Osteuropa. Bereits in der Antike und im Mittelalter führten wichtige Handelsstraßen durch das heutige Polen, wie zum Beispiel die Bernsteinstraßen, der europäische Abschnitt der Seidenstraße, die Handelsroute von Westeuropa nach Asien.
- Straßenverkehr

Autobahnnetz
Das Straßennetz verfügt über eine Gesamtlänge von etwa 382.000 km,[93] darunter ungefähr 1374 km Autobahnen und weitere 1050 km Schnellstraßen.
2007 war das polnische Autobahnverkehrsnetz noch zweieinhalbmal kleiner als das der Schweiz. Von 2007 bis 2012 wurde das Autobahnnetz nahezu verdoppelt, insgesamt um 672,5 Kilometer erweitert. Komplett ausgebaut soll das Netz knapp 2000 Kilometer betragen. Das Netz an Schnellstraßen betrug 2006 insgesamt 266,2 km. In den sechs Jahren von 2007 bis 2012 erfolgte die Fertigstellung von 854 Kilometern und die Verfünffachung des Schnellstraßennetzes. Das Straßennetz an Schnellstraßenverbindungen soll insgesamt 5500 km umfassen.
18.368 km Landesstraßen (poln.: droga krajowa) dienen – ähnlich wie die deutschen Bundesstraßen – dem nationalen und internationalen Verkehr. Zum 1. Januar 1999 wurden 28.444 km Landesstraßen zu Woiwodschaftsstraßen (poln.: droga wojewódzka) herabgestuft. Daneben gibt es noch 128.870 km Kreisstraßen (poln.: droga powiatowa) und 203.773 km Gemeindestraßen (poln.: droga gminna).[94]
In Polen sind über 12 Millionen Pkw und 2 Millionen Lkw und andere Nutzfahrzeuge registriert. Insgesamt waren Ende 2007 383 Pkw je 1000 Einwohner registriert, im EU-Durchschnitt sind es 486.[95]
Dem in Polen trotz wachsendem Individualverkehr immer noch sehr bedeutsamen öffentlichen Verkehr dient ein ausgedehntes Überlandbusnetz. Der Busverkehr spielt landesweit eine größere Rolle als der Eisenbahnverkehr.[96]
2004 starben in Polen 5700 Menschen bei Verkehrsunfällen, das bedeutet eine viermal höhere Rate als im Durchschnitt der EU.[97] Dies ist aber bereits eine Verringerung der Zahl, 1999 waren es noch 6730 Tote und 1998 – 7080.[98] Stellen mit einer hohen Unfallrate werden häufig durch einen sogenannten Schwarzen Punkt (czarny punkt) gekennzeichnet.
Es besteht seit 14. April 2007 die ganztägige und -jährige Lichtpflicht für Pkw und Lkw, wobei Abblend- oder Tagfahrlicht vorgeschrieben sind. Seit dem 1. Juni 2007 gilt beim Fahren von Kraftfahrzeugen ein absolutes Alkoholverbot, nachdem bis dahin eine Blutalkoholkonzentration von 0,2 Promille erlaubt war.

Schienennetz
Für Autobahnen, Schnell- und Landesstraßen ist auf ausgewählten Straßenabschnitten eine streckenabhängige Maut für Kraftfahrzeuge zu entrichten. Für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen (u. a. Lastkraftwagen) kommen ein als viaTOLL bezeichnetes System des staatlichen Betreibers GDDKiA sowie eine manuelle Mautentrichtung auf den Autobahnabschnitten der privaten Betreiber infrage. Für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von weniger als oder gleich 3,5 Tonnen (u. a. Personenkraftwagen) besteht auf den von der GDDKiA betriebenen Straßenabschnitten die Möglichkeit der Nutzung des viaTOLL-Systems oder der manuellen Mautabgabe an den Mautstellen. Auf Autobahnabschnitten der privaten Betreiber ist nur die manuelle Mautabgabe möglich.
- Schienenverkehr
Der Schienenverkehr spielt in Polen auch nach dem starken Wachstum des Individualverkehrs in den letzten zwei Jahrzehnten immer noch eine wichtige Rolle für das polnische Verkehrswesen. Die polnische Eisenbahninfrastrukturgesellschaft PKP PLK gehört zu den größten europäischen Eisenbahngesellschaften mit über 23.420 km Schienennetz. An der polnischen Ostgrenze trifft das europäische Normalspurnetz auf das breitere russische Gleissystem.
- Flugverkehr

Flughäfen
Polen hat 14 Flughäfen, 123 nationale Flugplätze und drei Hubschrauberbasen. Die Anzahl der Fluggäste ist in den letzten Jahren rasant gestiegen. Da die regionalen Flughäfen bereits an ihre Kapazitäten stoßen, wurde 2017 die Entscheidung gefällt, zwischen Warschau und Łódź bei Grodzisk Mazowiecki einen Zentralflughafen zu bauen, der eine Kapazität von jährlich ca. 50 Millionen Fluggästen haben soll, womit er einer der größten Flughäfen in Europa sein würde.
- Schifffahrt

Internationale Wasserstraßen
Die Überseehandelsflotte besteht aus über 100 Schiffen. Seehäfen befinden sich entlang der Ostseeküste, wobei die meiste Fracht in Danzig, Stettin-Swinemünde, Gdynia, Kołobrzeg und Elbląg umgeladen wird. Dazu kommt auch der Hafen Police, der vor allem den ortlichen Chemieindustrie-Anlagen dient. Passagierfähren verbinden ganzjährig Polen mit Skandinavien Passenger. Polferries hat ihre Häfen in Danzig und Świnoujści, Stena Line in Gdynia und Unity Line in Świnoujście.
Folgende regelmäßige Fährverbindungen bestehen:
- Danzig nach Nynäshamn (bei Stockholm)
- Gdynia nach Helsinki, Oxelösund und Malmö
- Swinemünde nach Kopenhagen, Malmö, Rønne (nur im Sommer) sowie Ystad
Die Binnenschifffahrt wird ausgebaut. Polen besitzt 3.812 Kilometer schiffbare Flüsse und Kanäle, von denen viele zu internationalen Wasserstraßen gehören. Die wichtigsten Häfen im Binnenland befinden sich in Warschau, Gliwice, Breslau und Krakau.
- Nahverkehr
Der Nahverkehr in Polen besteht vor allem aus Bussen und Straßenbahnen. Warschau hat auch eine U-Bahn und Krakau Łódź, Posen, Breslau, Danzig und Stettin haben ein Netz von Stadtschnellbahnen. In Lublin, Gdynia, Tychy und Sopot fahren Trolleybusse.
Bildung
- Schulsystem
Das erste moderne Bildungsministerium weltweit wurde 1773 im Zuge der Reformen im Geiste der Aufklärung in der polnisch-litauischen Adelsrepublik gegründet. Das heutige Bildungssystem in Polen befindet sich im Umbruch. Nach der Wende 1989 hab es zwei große Reformen 1999 und 2017. Nach den neuen Vorgaben sollen die 1999 eingeführten Gymnasien bis 2019 abgeschafft werden. Das Schulsystem wird dann aus Kindergärten, achtjährigen Grundschulen und weiterführenden Schulen wie vierjährigen Lyzeen, fünfjährigen Berufsoberschulen sowie weiteren berufsbezogenen Schulen bestehen. Das Abitur wird nach dem Abschluss eines Lyzeums oder einer Berufsoberschule abgelegt werden. Die Abiturprüfung soll wieder bedeutend schwieriger werden. Das Bestehen der Abiturprüfung ist Voraussetzung für das Studium an einer Hochschule. Seit 2017 haben die Eltern die Wahl, ob sie ihre Kinder mit sechs oder sieben Jahren einschulen lassen wollen. Die staatlichen Schulen sind kostenlos, Schulmittel, wie etwa Bücher, Hefte, Stifte oder Schulranzen, müssen aber privat getragen werden. Das Schuljahr beginnt am 1. September und endet in der ersten Junihälfte. Die Schulferien während des Schuljahres werden von den einzelnen Woiwodschaften beschlossen und sollen versetzt organisiert werden, damit nicht alle Kinder zur selben Zeit zum Beispiel in die Berge zum Skifahren fahren.
Im PISA-Ranking von 2015 erreichen polnische Schüler Platz 17 von 72 Ländern in Mathematik, Platz 22 in Naturwissenschaften und Platz 13 beim Leseverständnis. Polen liegt damit über dem Durchschnitt der OECD-Staaten.[99]
- Hochschulen

Collegium Maius der UJ-Krakau

Jesuitenkolleg, Keimzelle der UAM-Posen

Hauptgebäude der UW-Breslau

Campuseingang der UW-Warschau

Collegium Iuridicum der UŚ-Kattowitz
Die älteste polnische Universität, und gleichzeitig zweitälteste in Mitteleuropa, ist die Jagiellonen-Universität in Krakau, die 1364 von Kasimir dem Großen gegründet wurde. Die vier nächstältesten polnischen Universitäten in Vilnius (1579), Zamość (1594), Raków (1602) und Lemberg (1661) bestehen nicht mehr, bzw. wurden nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nach Breslau und Thorn verlegt. In Polen studieren fast zwei Millionen Studenten. Die Hochschulen sind von Anweisungen des Staates bezüglich ihrer Bildungsangebote seit der Wende 1989 weitgehend unabhängig. 2008 gab es in Polen 130 staatliche und 315 nichtstaatliche Hochschulen. Weiterhin gab es 78 Einrichtungen der Polska Akademia Nauk (Polnische Akademie der Wissenschaften) sowie etwa 200 selbständige Forschungseinrichtungen. Die staatlichen Hochschulen haben dabei seit den 1990er Jahren vermehrt Konkurrenz durch private Hochschulen bekommen. Das Studium an staatlichen Hochschulen in Polen ist in den Vollzeitstudiengängen grundsätzlich kostenlos. Berufsbegleitende Teilzeit-, Wochenend- und Fernstudiengänge als auch das Studium an privaten Hochschulen sind kostenpflichtig. Die Universitäten vergeben die Bezeichnungen Magister, Licencjat, Ingenieur, Doktor und Doktor hab. Der Magister wird nach einer vier- bis fünfjährigen Regelstudienzeit vergeben, die mit einer Abschlussarbeit beendet wird. In der Humanmedizin ersetzt der Abschluss Arzt der Humanmedizin den Magister, in der Tiermedizin heißt der entsprechende Abschluss Arzt der Veterinärmedizin. In technischen Studiengängen wird der Grad Magister durch den Zusatz Ingenieur ergänzt.
| Wappen | Name | Widmung | Sitz | Gründungsjahr | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
Jagiellonen Universität | Jagiellonen | Krakau | 1364 | ||
Universität Breslau | Breslau | 1702 | 1945 neugegründet durch Professoren der 1661 gegründeten Universität Lemberg | ||
Universität Warschau | Warschau | 1816 | |||
Katholische Universität Lublin | Johannes Paul II. | Lublin | 1918 | ||
Universität Posen | Adam Mickiewicz | Posen | 1919 | ||
MCS-Universität | Marie Curie-Skłodowska | Lublin | 1944 | ||
Universität Thorn | Nikolaus Kopernikus | Toruń | 1945 | 1945 gegründet durch Professoren der 1579 gegründeten Universität Vilnius | |
Universität Łódź | Łódź | 1945 | |||
Universität Stettin | Stettin | 1945 | |||
Kardinal-Stefan-Wyszyński-Universität | Kardinal Stefan Wyszyński | Warschau | 1954 | ||
Universität Kattowitz | Kattowitz | 1968 | |||
Universität Bydgoszcz | Kasimir der Große | Bydgoszcz | 1969 | ||
Universität Kielce | Jan Kochanowski | Kielce | 1969 | ||
Universität Danzig | Danzig | 1970 | |||
Universität Oppeln | Oppeln | 1994 | |||
Universität Białystok | Białystok | 1997 | |||
Universität Ermland-Masuren | Allenstein | 1999 | |||
Universität Rzeszów | Rzeszów | 2001 | |||
Universität Grünberg | Grünberg | 2001 |
Wissenschaft

Wissenschaftsakademie

Gelehrsamkeitsakademie

Aula der Krakauer Akademie
Bereits mit der Gründung der Bistümer im Jahr 1000 wurden nach und nach Kirchenschulen an den Bischofssitzen eröffnet. Mit dem Zisterzienser-Orden kam auch die abendländische Wissenschaft nach Polen. Bereits 1364 gründete Casimir der Große die Krakauer Universität, die die zweitälteste Alma Mater in Mitteleuropa ist. Sie war die erste Universität, die eine eigenständige Professur für Mathematik und Astronomie hatte. Ihr Rektor Paweł Włodkowic – einer der wichtigsten Völkerrechtler jener Zeit – stellte auf dem Konzil von Konstanz 1415 die These auf, dass heidnische Völker ein Recht auf einen eigenen Staat hätten und nicht mit dem Schwert christianisiert werden dürften. Dass er nicht das Schicksal seines Prager Kollegen Jan Hus teilen musste, verdankte er der zahlreichen polnischen Ritterschaft, die beim Konzil anwesend war.
Die Wissenschaft in Polen erreichte in der Zeit des Humanismus ihre Blüte. Einer der Krakauer Studenten war Nikolaus Kopernikus, der sich unter anderem hier das mathematische und astronomische Rüstzeug zu seiner späteren Entwicklung des heliozentrischen Weltbilds erwarb. Wichtige Astronomen und Mathematiker jener Zeit waren Marcin Król, Marcin Bylica, Marcin Biem, Johann von Glogau und Albert de Brudzewo. In der (Al)Chemie und Medizin waren damals Adam von Bochinia und Maciej Miechowita führend. Neue Universitäten wurden in Zamość, Raków, Wilna, Posen und Lemberg gegründet, zudem kamen die zahlreichen Schulen der Jesuiten. Nach den Kriegen des 17. Jahrhunderts verfiel die polnische Wissenschaft jedoch zusehends und erreichte in der sächsischen Zeit ihren Tiefpunkt. Eine Ausnahme bildete das 1740 von den Piaristen in Warschau gegründete Collegium Nobilium.
Mit dem Amtsantritt Stanisław August Poniatowskis begann in der Aufklärung die Neuorganisation der polnischen Universitäten durch Hugo Kołłątaj im Rahmen der Kommission für nationale Erziehung, dem ersten Bildungsministerium der Welt. Als einer der wichtigsten Wissenschaftler und Industrieller dieser Zeit gilt Stanisław Staszic, der um 1800 in Warschau eine Akademie der Wissenschaft ins Leben rief. 1817 wurde die Warschauer Universität gegründet. Auf dieser Grundlage konnte sich die polnische Wissenschaft im 19. Jh. entwickeln. Um 1850 entdeckte Ignacy Łukasiewicz eine Methode zur Destillation von Erdöl. Napoleon Cybulski und Władysław Szymonowicz schufen die moderne Endokrinologie. Zygmunt Wróblewski und Karol Olszewski gelang es erstmals, Sauerstoff und Stickstoff zu verflüssigen. Stefan Banach und Hugo Steinhaus begründeten die Funktionalanalysis in der Mathematik. Der Arzt Casimir Funk prägte den Begriff Vitamine. Marie Skłodowska-Curie entwickelte das Fachgebiet der Radioaktivität und entdeckte das Polonium und das Radium. Sie war die erste Frau, die einen Nobelpreis erhielt, und gleichzeitig der erste Mensch dem zwei zuerkannt wurden (Physik und Chemie). Eugeniusz Kwiatkowski entwickelte die polnischen Wirtschaftswissenschaften, die er nach der Unabhängigkeit Polens als Wirtschaftsminister in die Praxis umsetzen konnte.
In der Zweiten Republik wurde die polnische Sprache an den polnischen Universitäten wieder eingeführt und die Lehre und Wissenschaft florierten. Einer der größten polnischen Juristen Roman Longchamps de Bérier vereinheitlichte das polnische Zivilrechtssystem, das 1918 noch aus fünf Rechtsordnungen bestand. Sein Schuldrechtgesetzbuch gilt als eines der besten der Welt.
Der Zweite Weltkrieg war ein Desaster für die polnische Wissenschaft, denn die Nationalsozialisten wollten die polnischen Eliten vernichten. Bereits in den ersten Kriegswochen wurden hunderte polnischer Professoren ermordet oder in Konzentrationslager deportiert. Insoweit erlangte die Sonderaktion Krakau und das Massaker an den Lemberger Professoren traurige Berühmtheit. Auch die Sowjetunion führte derartige Aktionen durch; so waren unter den Opfern des Massakers von Katyn 21 Hochschullehrer, mehrere hundert Lehrer, etwa 300 Ärzte sowie andere Akademiker. Im Krieg wurden auch die polnischen Universitätsbibliotheken ausgeraubt und ihre Bestände zielgerichtet vernichtet, sodass 1945 ein völliger Neuanfang bevorstand. Zudem flohen viele der überlebenden Wissenschaftler vor den Kommunisten ins westliche Ausland und die überlebenden polnischen Juden emigrierten nach Israel. Die polnische Wissenschaft erholte sich nur langsam. Die polnischen Restauratoren konnten schon bald wieder Weltruhm genießen, doch den anderen Wissenschaften fehlte der Austausch mit den bereits führenden US-amerikanischen Universitäten. Dies änderte sich erst nach 1989. Im Jahr 2001 wurden die Erfolge zu Entwicklungen zum Blauen Lasers in der praktischen Medizin vorgestellt.

Nikolaus Kopernikus

Albert de Brudzewo
Johannes Hevelius
Stanisław Staszic

Marie Skłodowska-Curie

Stefan Banach
Kultur

Warschauer Mickiewicz-Denkmal
Die polnische Kultur ist sehr vielfältig und resultiert aus der wechselvollen Geschichte des Landes. Im Mittelalter und der Neuzeit war die multikulturelle Adelsrepublik ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen und Religionen, die alle ihren Einfluss auf das polnische Kulturerbe hatten und noch immer haben. Nach den Teilungen Polens versuchten polnische Künstler immer wieder den Kampf um die Unabhängigkeit Polens unter dem Schlagwort „Zur Hebung der Herzen“ zu unterstützen. Als Beispiele hierfür können die Gedichte und Epen von Adam Mickiewicz, die Prosawerke eines der ersten Literaturnobelpreisträgers Henryk Sienkiewicz, die Historienmalerei von Jan Matejko oder die Mazurkas, Polkas, Krakowiaks und Polonaisen von Frédéric Chopin genannt werden.
Heute ist die breit gefächerte Kultur Polens, ähnlich wie aller westlicher Staaten, von Globalisierungstendenzen insbesondere in den Großstädten betroffen, andererseits kann sie, gerade in der Kulturszene kleinerer Städte und auf dem Land eine eigene Identität erhalten. Besonders bedeutend ist der polnische Symbolismus und die polnische Plakatmalerei. Plakate polnischer Künstler mit ihren sehr spezifischen Eigenschaften sind auf der ganzen Welt bekannt.
Literatur
Mittelalter

Königin Hedwig-Psalter
Das älteste erhaltene polnische Schriftstück ist das Dagome-Iudex-Regest aus dem Jahr 991. Wie fast alle polnischen Werke des Mittelalters ist es in Latein geschrieben. Zu diesen gehören vor allem die Heiligengeschichten um die Fünf Heiligen Brüder, Adalbert von Prag, Stanislaus von Krakau von Brun von Querfurt und anderen sowie die Chroniken von Gallus Anonymus, Wincenty Kadłubek, Janko z Czarnkowa, Jan Długosz und Jan Łaski sowie diverse Jahrbücher, von denen die Heiligkreuz-Jahrbücher, Annalen des Domkapitels Krakau und Posener Annalen, die bekanntesten sind. Verschollen und nur aus sekundären Quellen sind die Jordanes-Annalen bekannt, die ältesten Jahrbücher in Polen. Zu den späteren Chroniken gehört die Großpolnische Chronik.
Zu den ältesten politischen Texten gehören die Kodifizierungen von Adelsprivilegien (siehe Verfassungsgeschichte der Adelsrepublik). Das älteste erhaltene Schriftstück in teilweise polnischer Sprache ist das Stiftbuch des Klosters Heinrichau und datiert aus dem 13. Jahrhundert. Es wurde in der Klosterbibliothek des Klosters gefunden.
Zu den ältesten religiösen Texten auf Polnisch gehören die Heilig-Kreuz-Predigten, die ältesten erhaltenen Schriftstücke, die ganz auf Polnisch geschrieben wurden, der Psalter der Königin Hedwig (älteste erhaltene Bibelübersetzung ins Polnische), die Bibel der Königin Sophia, der Puławy-Psalter, der David-Psalter, der Krakauer Psalter, die erste polnische Nationalhymne Bogurodzica sowie diverse Gebete und Heiligengeschichten. Zu den gemische lateinischen-polnischen religiösen Liedgut gehört Gaude Mater Polonia.
1473 wurden die ersten Schriftstücke in Krakau gedruckt, wo die erste Buchdruckerei Polens entstand. Mit der 1364 gegründeten Krakauer Universität war die damalige polnische Hauptstadt das Zentrum der polnischen Literatur des Spätmittelalters. Hier wirkten Gregor von Sanok, Paweł Włodkowic, Jakub von Paradyż, Stanisław von Skarbimierz, Paweł von Worczyn, Albert de Brudzewo, Jan von Ludzisko und Jan Ostroróg.
Zu der ältesten Dichtung am polnischen Königshof gehört das verschollene Epos Lied des Maur über die Heldentaten des Piotr Włostowic aus dem 12. Jahrhundert sowie das medizinische Gedicht Antipocras aus dem 13. Jahrhundert des Dominikaners Nicholaus Polonus, das gegen die Medizinlehre von Hippokrates von Kos argumentiert. Beide wurden auf Latein verfasst. Im 14. und 15. Jahrhundert entstanden immer mehr Dichtung in polnischer Sprache, unter anderem Das Gespräch des Meister Polikarb mit dem Tod. 1488 wurde die welterste Dichterbruderschaft Sodalitas Litteraria Vistulana von dem Deutschen Conrad Celtis und dem Italiener Kallimachus an der Universität in Krakau gegründet.
Renaissance

Die Babinische Republik
Die polnische Sprache setzte sich in der Renaissance durch, obwohl viele Autoren auch noch in Latein oder beiden Sprachen veröffentlichten. Der erste nur polnischschreibende Dichter war Mikołaj Rej, der als Vater der polnischen Sprache gilt. Der größte polnische Renaissancedichter war jedoch Jan Kochanowski, der mit dem ersten polnischen Drama „Die Abfertigung der griechischen Gesandten“ und zahlreichen Gedichten Weltruhm erlangte. Sein Theaterstück wurde in Warschau auf dem Sejm von 1578 bei Anwesenheit des Königspaares uraufgeführt. Andere wichtige Renaissanceschriftsteller waren Andrzej Frycz Modrzewski, Szymon Szymonowic, Andrzej Krzycki, Mikołaj Hussowski, Biernat z Lublina, Mikołaj Sęp Szarzyński und Johannes Dantiscus. Piotr Skarga und Łukasz Górnicki taten sich in der politischen Dichtung hervor, in der sie zu Reformen der Adelsrepublik drängten. Auch in der Renaissance blieb der Krakauer Königshof das Zentrum des literarischen Lebens in Polen. 1568 entstand am Königshof auf dem Wawel die Babinische Republik, eine humoristische litaratische Gesellschaft, die das Leben am Hofe im Zerrspiegel satirisch aufs Korn nahm. Während im Mittelalter vor allem Geistliche und Adelige literarisch tätig wurden, brachte die Renaissance die ersten bürgerlichen Dichter wie Sebastian Fabian Klonowic, Walenty Roździeński und Franciszek Śmiadecki in Polen hervor. Klemens Janicki galt trotz seiner bäuerlicher Herkunft als talentiertester lateinischschreibender Poet der Frührenaissance in Europa.
Barock

Oper im Warschauer Königsschloss nach Giovanni Battista Gisleni
Die polnische Barockliteratur lässt sich in drei Unterepochen einteilen. Die Frühphase fällt mit den letzten Jahrzehnten der Regierungszeit von Sigismund III. Wasa nach der Verlegung des Königshofs nach Warschau zusammen und ist noch stark von der Renaissance geprägt. In dieser Zeit entstand das erste Theater und die erste Oper auf dem Warschauer Königsschloss. In dieser Zeit waren insbesondere tätig: Kasper Miaskowski, Stanisław Grochowski, Sebastian Grabowiecki, Mateusz Bembus, Szymon Zimorowic sowie Piotr Kochanowski.
Die zweite Unterepoche beginnt mit dem Regierungsantritt Władysław IV. Wasa und endet mit dem Tod von Johann III. Sobieski. Dies ist vor allem die Zeit der vielen vernichtenden Kriege, die auf polnischem Boden ausgetragen wurden. Diese Epoche ist dem Motto memento mori treu und bringt im Gegensatz zum Harmoniebestreben der polnischen Renaissance die Unruhe der damaligen Zeit zum Ausdruck. Gleichzeitig ist dies die Epoche des Höhepunkts des Sarmatismus in der polnischen Literatur. Hervorzuheben sind hier die Liebesbriefe des Dichterkönigs Johann III. Sobieski an Königin Maria Kazimiera sowie die Kriegsmemoiren von Jan Chryzostom Pasek. Weitere wichtige Vertreter dieser Epoche waren Wacław Potocki, Jan Andrzej Morsztyn, Daniel Naborowski, Szymon Starowolski, Krzysztof Zawisza, Zbigniew Morsztyn, Maciej Sarbiewski, Benedykt Chmielowski sowie die Brüder Krzysztof Opaliński und Łukasz Opaliński. In dieser Zeit erschien auch die erste polnische Tageszeitung Merkuriusz Polski, die sich neben politischen auch literarischen Themen widmete.
Die dritte Unterepoche fällt mit der Regierungszeit der Wettiner August dem Starken und August III. zusammen, die auch als sächsische Nacht in der polnischen Literaturgeschichte bezeichnet wird. In dieser Zeit entstanden nur wenige bedeutende Werke, da die Wettiner die Kultur am Königshof in Warschau kaum förderten. Zu den Literaten dieser Zeit zählen Józef Baka, Jan Damascen Kaliński, Jan Skorski, Jan Stanisław Jabłonowski, Wacław Piotr Rzewuski, Wojciech Stanisław Chrościński, Elżbieta Drużbacka und Jędrzej Kitowicz. In den letzten beiden Jahrzehnten dieser Epoche kamen Schriftsteller wie Stanisław Konarski sowie der Gegenkönig Stanisław Leszczyński zu Wort, die bereits zur späteren Epoche der Aufklärung zu rechnen sind und die Reformen im Geist dieser Epoche forderten.
Aufklärung

Nationaltheater Warschau
Zentrum der polnischen Aufklärung war Warschau. Keine andere Kulturepoche als die Aufklärung und Klassik hat mehr Spuren in Warschau hinterlassen. Bereits in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts legten Institutionen wie die Załuski-Bibliothek, einer der ersten öffentlichen Bibliotheken Europas, und das Collegium Nobilium den Grundstein für die neue Kulturströmung. Grundsätzlich wird die Epoche der Aufklärung in der polnischen Literatur mit den Reformen in der Regierungszeit von Stanislaus Poniatowskis in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gleichgesetzt, der die führenden Literaten seiner Zeit zu den Donnerstagmittagessen einlud. Sprachrohr der Reformbewegung waren die 1765 und 1770 gegründeten Tageszeitung Monitor und Angenehme und Nützliche Spiele. Letztere widmete sich vor allem der Poesie. 1765 wurde auch das Nationaltheater Warschau gegründet, in dem die Dramaturgen der Aufklärung ihre Stücke aufführten. Neben Poesie, Theater und Roman waren auch politische Schriften, die die Reformbemühungen des Königs unterstützten, kennzeichnend für die Epoche. Viele Schriftsteller der polnischen Aufklärung engagierten sich für die Reformen des Großen Sejm und die Verfassung vom 3. Mai 1791. Insbesondere Ignacy Krasicki, Adam Naruszewicz, Wojciech Bogusławski, Franciszek Bohomolec, Franciszek Salezy Jezierski, Franciszek Karpiński, Franciszek Dionizy Kniaźnin, Hugo Kołłątaj, Stanisław Konarski, Julian Ursyn Niemcewicz, Stanisław Staszic, Stanisław Trembecki und Franciszek Zabłocki sind hier zu nennen.
Romantik

Nationalepos Pan Tadeusz
Nach der letzten Teilung Polens entstanden zwei gegensätzlich poetische Richtungen, die Klassik und die Romantik. Das Jahr 1822, als Adam Mickiewicz seinen ersten Gedichtband herausbrachte, gilt als endgültiger Sieg von letzterer. Damit entwickelte sich die Romantik in Polen ein Vierteljahrhundert später als im restlichen Europa, war dafür aber intensiv und begründete die bedeutende polnische Lyrik.[100] Die polnische Romantik, die in der Zeit zwischen dem Novemberaufstand 1830 und Januaraufstand 1863 ihren Zenit erreichte, hat sehr viele Poeten hervorgebracht. Viele der polnischen Literaten der Romantik kamen dabei aus Polnischen Osten, der heute zu Litauen, Weißrussland und der Ukraine gehört. Neben Mickiewicz allen voran Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński und Cyprian Kamil Norwid.[101] Nicht unerwähnt bleiben dürfen aber auch Stanisław Bogusławski, Adam Jerzy Czartoryski, Aleksander Fredro, Klementyna Hoffmanowa, Józef Ignacy Kraszewski, Wincenty Pol, Henryk Rzewuski, Kornel Ujejski, Feliks Bernatowicz, Ryszard Berwiński, Leszek Dunin-Borkowski, Józef Dunin-Borkowski, Kazimierz Brodziński, Antoni Czajkowski, Michał Czajkowski, Jan Czeczot, Franciszek Salezy Dmochowski, Józef Bohdan Dziekoński, Gustaw Ehrenberg, Stefan Garczyński, Antoni Gorecki, Seweryn Goszczyński, Józef Ignacy Kraszewski, Teofil Lenartowicz, Jadwiga Łuszczewska, Antoni Malczewski, Zygmunt Miłkowski, Maurycy Mochnacki, Mieczysław Romanowski, Lucjan Siemieński, Wincenty Stroka, Władysław Syrokomla, Maria Wirtemberska, Józef Bohdan Zaleski und Narcyza Żmichowska. Eines der Leitmotive der polnischen Romantik war die Wiedererlangung der Unabhängigkeit und den Umsturz der Ordnung des Wiener Kongresses auf dem Weg eines Gesamtpolnischen Aufstandes gegen die Teilungsmächte, gegebenenfalls im Rahmen eines Gesamteuropäischen Weltkrieges der Teilungsmächte gegeneinander. Oft wurde dabei die Erlangung der Unabhängigkeit Polens während des kurzlebigen Herzogtum Warschau sowie Napoleons Russlandfeldzug 1812 thematisiert, so zum Beispiel in Mickiewiczs Nationalepos Pan Tadeusz. Viele Literaturkritiker sehen in der polnischen Romantik die Epoche, die die polnische Kultur am meisten beeinflusst hat und am meisten auf die anderen Richtungen einwirkte.
Positivismus

„Fackeln des Nero“ als Inspiration für „Quo vadis“

„Eine christliche Dirke“ inspiriert von „Quo vadis“
Nach der Niederschlagung des Januaraufstandes 1864 kam die Erkenntnis auf, dass man die Eigenstaatlichkeit nicht in naher Zukunft durch einen Aufstand gegen die Teilungsmächte erringen wird können. Die junge Generation der polnischen Schriftsteller wandte sich daher vom Romantismus ab und suchte andere Wege, die polnische Sache zu fördern. Diese Epoche, die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts dauerte wird als die Zeit des Positivismus bezeichnet. Als endgültiger Wendepunkt vom Romantismus zum Positivismus und gleichzeitig Höhepunkt des ideologischen Konflikts zwischen alter und junger Schriftstellergeneration wird Aleksander Świętochowskis Artikel „Wir und Ihr“ angesehen, in dem er die Grundthesen des Positivismus darlegte. Insbesondere setzte man auf eine möglichst weitreichende Autonomie, so in Galizien nach dem ungarisch-österreichischen Ausgleich 1867, Industrialisierung, Bildung und Wohlfahrtseinrichtung für die unteren Bevölkerungsschichten. Der Positivismus ist auch als Widerstandsbewegung gegen Bismarcks Kulturkampf zu verstehen, der insbesondere in Großpolen auch ein Kampf gegen das polnische Nationalbewusstsein war. Für die Literaten dieser Epoche waren auch die integration ethnischer und nationaler Minderheiten und die Gleichberechtigung der Frauen von Bedeutung. Zum ersten Mal in der polnischen Literaturgeschichte bildeten Frauen ein große Anzahl an erfolgreichen Schriftstellerinnen. Die wichtigsten Autoren dieser Zeit kamen aus Kongresspolen, dem Teilungsgebiet in dem der Januaraufstand stattgefunden hat. Hierbei wird der Warschauer Positivismus oft als ein eigenes Kulturphänomen betrachtet, der sich von dem Gesamtpolnischen Positivismus unterschied. Die Dichtung spielte im Positivismus eine geringere Rolle. Die Literaten versuchten vor allem in der Prosa, insbesondere im realistischen Roman und im Drama ihrem Anliegen Ausdruck zu verleihen.
Als wichtigste Romanautoren des Positivismus gelten Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus und insbesondere Henryk Sienkiewicz, der als erster Pole und einer der ersten Schriftsteller überhaupt den Nobelpreis für Literatur erhielt. Entscheidend hierfür war sein opus magnum Quo vadis, das bereits vor dem Ersten Weltkrieg zweimal verfilmt wurde. Inspiert wurde Sienkiewicz von Henryk Siemiradzki Bild „Die Fackeln des Nero“, den wiederum Quo vadis zu seinem Werk „Eine christliche Dirke“ inspirierte. Andere wichtige Romane der Epoche waren die Trilogie Mit Feuer und Schwert, Sintflut und Pan Wołodyjowski sowie Die Kreuzritter und Na marne von Henryk Sienkiewicz als auch Puppe und Pharao von Bolesław Pruss sowie An der Memel von Eliza Orzeszkowa. Andere wichtige Romanautoren waren Maria Konopnicka, Adolf Dygasiński, Ludwika Godlewska, Wiktor Gomulicki, Maria Rodziewiczówna, Antoni Sygietyński, Aleksander Świętochowski und Gabriela Zapolska. Wichtige Vertreter des Positivismus in der Lyrik waren Adam Asnyk, Maria Ilnicka, Felicjan Faleński, Aleksander Michaux und Wacław Rolicz-Lieder. Zur Entwicklung des positivistischen Theater haben insbesondere beigetragen Michał Bałucki, Józef Bliziński, Edward Lubowski, Józef Narzymski, Zygmunt Sarnecki, Józef Szujski, Aleksander Świętochowski und Kazimierz Zalewski.
Junges Polen

Literatenenklave Zakopane
Als Gegenreaktion auf den Positivismus entstand um 1890 eine neue Kulturströmung, die sich auf die Romantik zurückbesann und sich Junges Polen nannte. Die Jungen Polen lehnten den Positivismus als Philistertum ab. Während die Positivisten vor allem in Warschau und Kongresspolen einflussreich waren, wurde Galizien, insbesondere Krakau und die neue Künstler- und Literaturhochburg Zakopane, das Zentrum der Jungen Polen. Dort ließen sie sich von der Folklore der Góralen und dem Zakopane-Stil beeinflussen. Die Schriftsteller des Jungen Polens gehörten der in den 1860er und 1870er Jahren geborenen Generation an. Kennzeichnend für diese Epoche war der Kulturpessimismus und eine gewisse Dekadenz. Viele Literaten dieser Zeit experimentierten mit Alkohol, insbesondere Absinth, und anderen Drogen, weshalb auch viele jung verstarben. Das Junge Polen zeichnete sich durch eine dem Symbolismus folgende Mystifizierung der Wirklichkeit aus. Das wichtigste Werk ist Wyspiańskis „Hochzeit“. Zu den wichtigsten Dichtern des Jungen Polens gehörten Bogusław Adamowicz, Tadeusz Boy-Żeleński, Mateusz Sabat, Wacław Berent, Stanisław Brzozowski, Stanisław Korab-Brzozowski, Wincenty Korab-Brzozowski, Zdzisław Dębicki, Jan Kasprowicz Zygmunt Kawecki, Jan August Kisielewski, Antoni Lange, Jan Lemański, Bolesław Leśmian, Ignacy Maciejowski, Józef Mączka, Zofia Trzeszczkowska, Tadeusz Miciński, Antoni Mueller, Andrzej Niemojewski, Franciszek Henryk Nowicki, Władysław Orkan, Artur Oppman, Bronisława Ostrowska, Włodzimierz Perzyński, Franciszek Mirandola, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Zenon Przesmycki, Stanisław Przybyszewski, Władysław Reymont, Tadeusz Rittner, Wacław Rolicz-Lieder, Lucjan Rydel, Wacław Sieroszewski, Edward Słoński, Leopold Staff, Ludwik Maria Staff, Wincenty Stroka, Ludwik Szczepański, Maryla Wolska, Wacław Wolski Stanisław Wyrzykowski, Gabriela Zapolska, Stefan Żeromski, Jerzy Żuławski und Stanisław Wyspiański.
Zwischenkriegszeit

PEN-Club mit Präsident Mościcki
In der Zwischenkriegszeit hatte Polen eine Reihe von hervorragenden Literaten, die in verschiedenen Richtungen experimentierten und verschiedene Dichtervereinigungen, wie zum Beispiel Skamander, Grüner Ballon, bildeten. Zu diesen gehörten Jan Brzechwa, Zofia Charszewska, Józef Czechowicz, Maria Dąbrowska, Albin Dziekoński, Bruno Jasieński, Witold Gombrowicz, Jarosław Iwaszkiewicz, Maria Kuncewiczowa, Jan Lechoń, Bolesław Leśmian, Józef Mackiewicz, Kornel Makuszyński, Antoni Marczyński, Czesław Miłosz, Stanisław Młodożeniec, Zofia Nałkowska, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Julian Przyboś, Bruno Schulz, Antoni Słonimski, Andrzej Strug, Julian Tuwim, Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) Aleksander Wat, Kazimierz Wierzyński und Stefan Żeromski. Władysław Reymont erhielt 1924 für seinen Roman „Die Bauern“ den Nobelpreis für Literatur. 1920 wurde in Warschau der Polnische Literatenbund, 1922 die Krakauer Avantgarde, 1924 der Polnische PEN-Club und 1933 die Polnische Literaturakademie gegründet.
Während des Zweiten Weltkrieges schuf die junge Generation der sogenannten Generation Kolumbus, auch Generation 1920 genannt. Zu deren Vertreter gehörten Jan Józef Szczepański, Gustaw Herling-Grudziński, Anna Kamieńska, Lech Bądkowski, Krzysztof Kamil Baczyński, Zdzisław Stroiński, Roman Bratny, Witold Zalewski, Tadeusz Różewicz, Tadeusz Borowski, Tadeusz Gajcy, Andrzej Trzebiński, Bohdan Czeszko und Józef Hen, die zum großen Teil sehr jung starben und diese Vorahnung in ihren Gedichten thematisierten. Alle von ihnen wurden um das Jahr 1920 geboren und legten um 1939 das Abitur ab, viele von ihnen im Warschauer Aufstand 1944. Der Name Generation Kolumbus geht auf den Roman Kolumbowie. Rocznik 20 von Roman Bratny zurück und ist dahin gehend zu verstehen, dass die um 1920 geborene Dichtergeneration während des Zweiten Weltkriegs Erfahrungen machen musste, die keine Generation vor ihnen gemacht hat.
Nachkriegszeit

Krakauer Altes Theater

Krakauer Słowacki-Theater
Die polnische Nachkriegsliteratur ist sehr mannigfaltig. Sie reicht vom Sozrealismus Jerzy Andrzejewskis bis zur Science Fiction Stanisław Lems. Zunächst war Hauptthema die Verarbeitung des Zweiten Weltkrieges, später wandten sich die Kulturschaffenden der neuen Wirklichkeit zu. Dabei muss zwischen den Schriftstellern unterschieden werden, die aufgrund des Zweiten Weltkriegs (Londoner Exilregierung, Pariser Kultura, Zwangsarbeiter, Displaced Persons, Mitglieder der polnischen Streitkräfte im Westen etc.) sich im westlichen Ausland befanden, und denen, die sich im sowjetisch besetzten Polen wiederfanden. Im Stalinismus waren keine systemkritische Werke in Polen möglich. Unabhängige polnische Literatur konnte nur im Westen erscheinen, unter anderem Gustaw Herling-Grudzińskis „Welt ohne Erbarmen“ über die sowjetischen Gulags. Viele bedeutende Vorkriegsschriftsteller wie Julian Tuwim oder Jan Brzechwa begannen Lobeshymnen auf Stalin zu dichten andere wählten die innere Emigration. Den Tiefpunkt erreichten die Literaten der Stalinzeit, unter anderem die spätere Literaturnobelpreisträgerin Wisława Szymborska, in dem Beschluss der Polnischen Literaten in Krakau von 1953, in dem sie Vollstreckung der Todesstrafen des Schauprozesses gegen die Bischöfe der Krakauer Kurie verlangten. Die Aufarbeitung der stalinistischen Literaten erfolgte erst nach Stalins Tod unter anderem in dem Band „Verführtes Denken“ des Literaturnobelpreisträgers Czesław Miłosz oder „Heimschande“ von Jacek Trznadel durch Schriftsteller, die ins Ausland emigriert waren. Erst in der Zeit des Tauwetters wagten es die daheim gebliebenen Schriftsteller, die neue Wirklichkeit zu kritisieren, so zum Beispiel im Brief der 34 an den Premierminister Józef Cyrankiewicz.
Wichtige Vertreter der Nachkriegsliteratur sind Witold Gombrowicz, Sławomir Mrożek, Jerzy Andrzejewski, Miron Białoszewski, Kazimierz Brandys, Marian Brandys, Ernest Bryll, Konstanty Ildefons Gałczyński, Zbigniew Herbert, Marek Hłasko, Paweł Huelle, Kazimiera Iłłakowiczówna, Jarosław Iwaszkiewicz, Mieczysław Jastrun, Stanisław Jerzy Lec, Jan Lechoń, Ewa Lipska, Stefan Kisielewski, Zofia Kossak-Szczucka, Leon Kruczkowski, Tadeusz Nowakowski, Jan Parandowski, Sergiusz Piasecki, Jerzy Pilch, Julian Przyboś, Tadeusz Różewicz, Andrzej Szczypiorski, Władysław Terlecki, Jan Twardowski, Ryszard Kapuściński, Stefan Chwin, Leszek Kołakowski, Halina Poświatowska, Jerzy Prokopiuk, Tadeusz Różewicz, Antoni Słonimski, Andrzej Stasiuk, Jan Józef Szczepański, Leopold Tyrmand, Olga Tokarczuk, Jan Twardowski, Dorota Masłowska, Adam Ważyk, Józef Wittlin und Kazimierz Wierzyński sowie auch der als Papst Johannes Paul II. bekannte Karol Wojtyła.
Zu den wichtigsten Bühnen im Nachkriegspolen gehörten die drei Krakauer Theater Helena Modrzejewska Altes Theater, Juliusz-Słowacki-Theater und Tadeusz Kantors absurdes Theater Cricot 2 sowie die Warschauer Bühnen Theater Roma, Nationaltheater und Großes Theater.
Bisher erhielten polnische Schriftsteller vier Mal den Literaturnobelpreis: 1905 (Henryk Sienkiewicz), 1924 (Władysław Reymont), 1980 (Czesław Miłosz) und 1996 (Wisława Szymborska). Zählt man den polnischstämmigen und auf Jiddisch wirkenden Amerikaner Isaac Bashevis Singer hinzu, der den Preis 1978 entgegennahm, so kommt man auf fünf polnische Preisträger in dieser Kategorie.
Jan Długosz

Jan Kochanowski
Jan Andrzej Morsztyn

Ignacy Krasicki
Adam Mickiewicz
Henryk Sienkiewicz

Stanisław Wyspiański

Zofia Nałkowska

Zbigniew Herbert
Musik

Philharmonie Warschau um 1920

Philharmonie Stettin

Musikforum Breslau

Freiluftkonzert am Chopin-Denkmal
Mittelalter
Die ersten erhaltenen polnischen Kompositionen gehen auf die Regierungszeit Mieszko II. Lambert Anfang des 11. Jahrhunderts zurück. Der erste namentlich bekannte Musiker Polens ist der Dominikaner Wincenty z Kielczy, der in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts lebte und die Hymne „Gaude mater Polonia“ schrieb. Dagegen ist der Autor des ältesten bekannten polnischen Liedes Bogurodzica unbekannt. Neben Hymnen zeichnete sich die mittelalterliche polnische Musik durch Tänze aus. Mikołaj Radomski schrieb diese am Anfang des 15. Jahrhunderts auf. Peter von Graudenz war ein Komponist der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, der mit der Krakauer Akademie verbunden war.
Renaissance
In der Renaissance kamen viele italienische Musiker an den polnischen Königshof. Mikołaj Gomółka war der bekannteste polnische Komponist des 16. Jahrhunderts. Er schrieb Kompositionen unter anderem zu den Gedichten von Jan Kochanowski (Melodie na Psałterz polski). Andere wichtige Renaissancekomponisten am polnischen Königshof waren Wacław von Szamotuł, Marcin Leopolita, Mikołaj Zieleński und Jakub Polak, der auch in Frankreich tätig war. Johannes von Lublin war ein bedeutender Kirchenmusiker in Krakau, der vor allem mit der dortigen Heilig-Geist-Kirche verbunden war. 1540 wurde am Krakauer Königshof von Sigismund I. der Männerchor Capella Rorantistarum unter der Leitung von Nikolaus aus Posen gegründet, der von 1543 bis 1794 in der Wawel-Kathedrale tätig war.
Barock
1628 wurde in Warschau die erste Oper außerhalb Italiens aufgeführt: Galatea. Die italienischen Opernkomponisten Luca Marenzio, Giovanni Francesco Anerio, and Marco Scacchi waren zur Barockzeit in Warschau tätig. Während der relativ kurzen Regentschaft von Władysław IV. Wasa von 1634 bis 1648 wurden in Warschau mehr als zehn Opern aufgeführt, womit Warschau zu dieser Zeit zum wichtigsten Opernzentrum außerhalb Italiens wurde. Die erste Opernkomponistin der Welt, Francesca Caccini, schrieb ihre erste Oper La liberazione di Ruggiero dall’isola d’Alcina für den polnischen König, als dieser noch ein Prinz war. Die polnischen Barockkomponisten komponierten vor allem Kirchenmusik, allen voran ihr bekanntester Schöpfer Adam Jarzębski, Marcin Mielczewski, Bartłomiej Pękiel und Grzegorz Gerwazy Gorczycki.
Klassik
In der späten Barockzeit entstand auch die Polonaise als Tanz an polnischen Höfen, während die bäuerliche Gesellschaft regional unterschiedliche Tänze wie die Mazurkas, Krakowiaks und Chodzony und die auch in Tschechien bekannten Polkas entwickelte. Die wichtigsten Polonaise-Komponisten im 18. Jahrhundert waren Michał Kleofas Ogiński, Karol Kurpiński, Juliusz Zarębski, Henryk Wieniawski, Mieczysław Karłowicz und Joseph Elsner. Im 18. Jahrhundert entwickelte sich auch die polnische Oper weiter. Bekannte Opernkomponisten waren Wojciech Bogusławski und Jan Stefani. Die erste polnische Symphonie komponierte Jacek Szczurowski um 1750.
19. Jahrhundert
Gleichwohl sollte erst Frédéric Chopin in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die polnische Musik zur Vollendung bringen. Er gilt als einer der größten polnischen Komponisten. Im 19. Jahrhundert entwickelte Stanisław Moniuszko die moderne polnische Oper, deren berühmtestes Werk Halka ist. Oskar Kolberg begann zu dieser Zeit die polnische Folkloremusik zu sammeln und niederzuschreiben. Seinen Werken verdanken die Folkloreensembles Mazowsze, Słowianki und Śląsk ihr Entstehen. Karol Szymanowski, der sich in Zakopane niederließ, entdeckte die traditionelle Musik der Goralen in Podhale, die er im 19. Jahrhundert weiter entwickelte.
20. Jahrhundert
Berühmte Komponisten der Zwischenkriegszeit waren Arthur Rubinstein, Ignacy Jan Paderewski, Grażyna Bacewicz, Zygmunt Mycielski, Michał Spisak and Tadeusz Szeligowski. Die zeitgenössische polnische Musik wird von Stanisław Skrowaczewski, Roman Palester, Andrzej Panufnik, Tadeusz Baird, Bogusław Schaeffer, Włodzimierz Kotoński, Witold Szalonek, Krzysztof Penderecki, Witold Lutosławski, Wojciech Kilar, Kazimierz Serocki, Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Meyer, Paweł Szymański, Krzesimir Dębski, Hanna Kulenty, Eugeniusz Knapik und Jan A. P. Kaczmarek repräsentiert. Jazzmusiker Polens werden zu den besten Europas gezählt. In den 1950er Jahren entwickelte sich der Jazz zu einer wichtigen Musikrichtung des Landes. Das Jazz Jamboree findet seit 1958 statt und schon zur Zeit der Volksrepublik Polen traten US-amerikanische Musiker wie etwa Miles Davis auf.[102]
21. Jahrhundert
Die zeitgenössische Musik in Polen unterscheidet sich aufgrund der Globalisierung der Musikszene kaum von der Musik in anderen Teilen der globalisierten Welt. Dies gilt insbesondere für die Pop- und Rockmusik, aber auch für Komponisten der klassischen Musik des 21. Jahrhunderts.

Mikołaj Gomółka
Wacław z Szamotuł

Grzegorz Gerwazy Gorczycki
Wojciech Bogusławski

Frédéric Chopin

Stanisław Moniuszko

Karol Szymanowski

Artur Rubinstein

Wojciech Kilar
Bildende Kunst

Steinzeitliche Bronocice Vase

Vorromanische Włocławek Schale

Romanische Fresken Tum

Romanische Strzelno-Säule

Replik der Krone Boleslaus I.

Gotisches Jüngstes Gericht

Gotischer Krakauer Hochaltar

Gotisches Sigismund-Reliquiar

Renaissance Sigismundkapelle

Renaissance Wawelaltar

Renaissance Wawel-Wandteppiche

Manieristische Firlejkapelle

Blockes Danziger Roter Saal

Möllers Danziger Gesellschaft

Blockes barocker Neptunbrunnen

Dębniker Marmor der Vasa-Kapelle

Perettis Stuck in Vilnius

Studzińskis Barockorgel in Leżajsk

Siemiginowskis Madonna mit Kind

Fesingers Kirchenfiguren

Czechowiczs Heiliger Ulrich

Canalettos Warschauer Panorama

Thorvaldsens Potocki-Christus

Jan Matejkos Grunwaldschlacht

Gierymskis Im Salettl

Mehoffers Seltsamer Garten

Zemłas Gefallene-Unbesiegte

Mitorajs Warschauer Bronzetür
Steinzeit
Die ältesten Kunstgegenstände, die in Polen gefunden wurden, waren aus Feuerstein, Bernstein sowie Tierknochen und stammen aus dem Paläolithikum. Sie wurden insbesondere in den kleinpolnischen Höhlen des Krakau-Tschenstochauer Juras (Fledermaushöhle und Maszycka Höhle) und der Pieninen (Obłazowa Höhle) gefunden und befinden sich zum großen Teil im Krakauer Archäologischen Museum. Altsteinzeitliche Figuren aus Bernstein wurden in Großpolen gefunden.
In der Zeit des Neolithikums befand sich das Gebiet des heutigen Südpolens im Einflussbereich der linearbandkeramischen Kultur. Verzierte Keramikgefäße wurden unter anderem in Dobra gefunden. Verzierter Schmuck aus Brześć Kujawski wird der Lengyel-Kultur zugeordnet. Zahlreiche Tongefäße aus der um ca. 1000 Jahre jüngeren Trichterbecherkultur wurden unter anderem in Ćmielów gefunden. Eine Lammfigur aus Jordanów entstammt ebenfalls der Trichterbecherkultur. Feuerstein wurde in der Jungsteinzeit unter anderem in Krzemionki abgebaut und kunstvoll verarbeitet. Viele der Funde aus der Jungsteinzeit, unter anderm aus der Kugelamphoren-Kultur und der Schnurkeramische Kultur, stammen aus dem Heiligkreuzgebirge und seiner Umgebung, insbesondere bei Sandomierz. Zu ihnen gehört die auf 3635-3370 v. Chr. datierte Vase aus Bronocice, auf der sich die älteste bekannte Abbildung eines Wagens mit Rädern befindet.
Bronzezeit
In der Bronzezeit war das heutige Gebiet Polens Teil der Lausitzer Kultur. Aus dieser Zeit stammen Kunstwerke wie verzierte Gefäße, Kultgegenstände, Figuren von Tieren, Vögeln und Menschen aus Bronze und Keramik. Gegen Ende der Bronzezeit entstanden in Polen größere Siedlungen insbesondere Pfahlbauten in der Großpolnischen Seenplatte, von den die Siedlung in Biskupin die bekannteste ist. Sie wird auch mit der Hallstattkultur in Verbindung gebracht. Weitere wichtige Fundstätten aus der Bronzezeit befinden sich in Żagań, Uścikowice und Brzezie bei Pleszew.
Eisenzeit
Am Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit entstand auf dem Gebiet des heutigen Polens die Pommerellische Gesichtsurnenkultur. Erhaltene Kunstwerke dieser Kultur waren vor allem Grabbeilagen. Auf den Urnen der Verstorbenen bildeten die Künstler das Gesicht der Toten sowie Alltagsgegenstände und Waffen manchmal auch ganze Szenen aus dem Leben der Verstorbenen ab. Die Urnen wurden von oben mit Deckeln verschlossen, die wie eine Kopfbedeckung geformt waren, sowie mit Halzketten verziert. An die Urnen wurden wie Ohren mit Ohrringen geformte Anhänge befestigt, so dass die Urne an einen menschlichen Kopf erinnerte. Fundorte dieser Kunstwerke waren unter anderem Deszczno, Rzadków, Niepoczołowice und Grabów Bobowski. In der späten Eisenzeit entstand in Nord- und Ostpolen die Wielbark-Kultur, die oft mit den Goten in Verbindung gebracht wird. Auch hier wurden Kunstwerke als Grabbeilagen in den als Steinkreise angelegten Kurganen in Odry, Węsiory, Grzybnica und Brąchnówko gefunden.
Antike
Im 6. und 5. Jahrhundert v. Chr. geriet das Gebiet des heutigen Polens unter keltischen und thrakischen Einfluss. Die Kelten und Anartier haben vor allem in Schlesien und Kleinpolen große Steinkunstwerke hinterlassen, unter anderem die Bärenfigur auf dem Berg Ślęża. Keltische Kunstwerke wurden auch in Großpolen bei Kalisz gefunden. In römischer Zeit dominierte die Przeworsk-Kultur im heutigen Polen. Aus dieser Zeit wurden zahlreiche Keramikgegenstände und Schmuck als Grabbeilagen in ganz Polen gefunden, unter anderem in Jakuszowice, Dobrodzien und Radziejów Kujawski. Das bekannteste Kunstwerk der Przeworskier Kultur war die einer Frau als Grabbeilage beigefügte unter anderem mit Reitern verzierte Vase von Biała bei Łódź. Sie ist während des Zweiten Weltkriegs verschollen. Über die Bernsteinstraße fand ein reger kultureller Austausch mit dem Römischen Reich statt. Römische Münzen und Kunstwerke (Keramik, Schmuck) wurden unter anderem in Wymysłów, Goszczyn, Gosławice, Łęg Piekarski und Rządz.
Vorromanik
Zur heidnischen Zeit schufen die westslawischen Künstler Steinfiguren von Światowit und anderen Gottheiten. Die bekannteste dieser Figuren ist das Idol von Sbrutsch, das sich im Krakauer Archäologischen Museum befindet. Im Frühmittelalter entstanden auch slawische Grabhügel, unter anderem der Krak-Hügel und der Wanda-Hügel in Krakau. Westslawische Keramik wurde unter anderem in Bródno, heute ein Stadtteil von Warschau, gefunden. Aus dieser Zeit stammen auch zahlreiche Bildwerke aus Holz und Stein, die meist einem reliösen Ritus dienten. Mit dem Übergang zum Christentum behielt die Kunst zunächst ihren rituellen Charakter. Bekanntestes Kunstwerk mit christlichem Charakter aus dem 10. Jahrhundert in Polen ist die Włocławek Schale, die 1909 bei Włocławek gefunden wurde. Zentrum der vorromanischen Kunst war der Königshof in der damaligen Hauptstadt Gnesen. Cosmas von Prag berichtet in seiner Chronica Boemorum, dass Břetislav I. nach der Plünderung von Gnesen 1039 hundert Ochsenwagen mit Kunstwerken aus Gnesen nach Prag gebracht hat.
Romanik
Der Übergang von Vorromanik zur Romanik wird in der polnischen Kunstgeschichte mit der Verlegung der Hauptstadt von Gnesen nach Krakau auf ca. 1040 datiert. Gleichwohl blieb neben Krakau Großpolen das Zentrum der romanischen Kunst in Polen. Die Künstler der Romanik arbeiten noch anonym, ihre Namen und ihre Herkunft ist meist unbekannt. Die meisten romanischen Kunstwerke entstanden als Teil der Ausstattung von Kirchen und Klöstern.
In der Malerei sind Fresken unter anderem im Kollegiatstift in Tum bei Łęczyca und der Basilika in Czerwińsk sowie Buchmalereien unter anderen in dem Pułtusk-Kodex, Emmeram-Evangeliar, Tyniec-Sakramentar, Czerwińsk-Bibel und der Goldene Gnesener-Kodex erhalten.
In der Bildhauerkunst sind vor allem die Kirchenportale mit Tympanon der von Jacza von Köpenick und Piotr Włostowic gestifteten St. Maria auf dem Sande in Breslau und Sankt-Prokop-Rotunde in Strzelno zu nennen. In Strzelno sind auch mit allegorischen Figuren der Tugenden und Laster reich verzierte romanische Säulen in der Dreifaltigkeits- und Marienkirche erhalten. In der Basilika von Wiślica ist die Wiślica-Platte erhalten, die Betende in der Orantenhaltung darstellt. Daneben waren in den romanischen Kirchen Steinfiguren und Reliefs sehr beliebt.
Einen bedeutenden Bestandteil der romanischen Kunst bildete das Goldschmiedehandwerk und die Bronzeplastik. Zu nennen sind insbesondere das Kruszwica-Reliquiar und zahlreiche goldene Messgefäße, insbesondere aus Gnesen, Trzemeszno, Kalisz und Płock, die meist von dem polnischen Königshof gestiftet wurden. Aus der Romanik stammen auch die ältesten polnischen Kronjuwelen. Das Krönungsschwert Szczerbiec und drei Kronen, von denen sich zwei in Krakau und eine in Płock, das sogenannte Płock-Diadem, befindet, sind erhalten geblieben. Die meisten anderen polnischen Kronjuwelen wurden nach der dritten polnischen Teilung von den Preußen aus dem Kronschatz des Wawels geraubt und im 19. Jahrhundert eingeschmolzen. Nachbildung der ursprünglichen polnischen Kronjuwelen wurden 2001–2003 und 2010 in Nowy Sącz gegossen und werden in Wechselausstellungen gezeigt. Zu den bedeutendsten erhaltenen Kunstwerken der Romanik gehören die monumentale Bronzetür der Erzkathedrale von Gnesen und die Bronzetür der Kathedrale von Płock. Die erste stellt die Lebensgeschichte des heiligen Adalbert (Wojciech) dar. Die zweite stellt den Zyklus der Erlösung von der Genesis bis zum Neuen Testament dar und wurde später unter nicht mehr rekonstruierbaren Umständen in die Stadt Nowgorod in Russland verbracht. In der Kathedrale von Płock befindet sich heute eine Kopie der ursprünglichen Bronzetür.
Gotik
In der Frühgotik war Polen im Rahmen der Senioratsverfassung in mehrere Fürstentümer zersplittert, die dem in Krakau residierenden Senior untergeordnet waren. Dies begünstigte eine territorial unterschiedliche Entwicklung der einzelnen Landesteile. Die Frühgotik setzte sich zunächst in Südpolen, insbesondere in Schlesien und Kleinpolen, durch und war stark von Böhmen beeinflusst. In Nordpolen, insbesondere in Pommern und Preußen, war die Backsteingotik vorherrschend, die über die Hanse und den Deutschen Orden stark von Norddeutschland, Flandern und insbesondere den Niederlanden geprägt war. In der Gotik entwickelte sich die Malerei, Holzschnitzerei, die Bronzegießerei, die Bildhauerei und das Goldschmiedehandwerk.
Ebenso wie in der Romanik bildeten Fresken in sakralen aber auch profanen Gebäuden den Hauptbestandteil der gotischen Malerei. Zu nennen sind insbesondere die Fresken der Turmburg in Siedlęcin, des Klosters Ląd, der Jakobskirche in Thorn, sowie der zahlreichen gotischen Klöster in Krakau, insbesondere des Franziskanerklosters. Eine Besonderheit der polnischen gotischen Malerei ist die Verbindung von östlicher Ikonenmalerei als Fresken in gotischen Kapellen, so zum Beispiel in der Heiligkreuzkapelle in der Wawel-Kathedrale und in der Dreifaltigkeitskapelle im Schloss Lublin. Neben Fresken spielten in der Gotik auch Buntglasfenster eine wichtige Rolle in der gotischen Kunst. Krakau war das Zentrum dieser Kunstart in Polen. Gotische Buntglasfenster sind insbesondere in der Krakauer Marien-, Dominikaner- und Fronleichnamkirche erhalten. Auch der Breslauer Dom, die Marien- und die Nikolauskirche in Toruń sowie die Marienkirche in Chełmno verfügen über beutende gotische Buntglasfenster.
In der Hochgotik entwickelte sich auch die Tafelbildmalerei in Polen und ist insbesondere mit der Bemalung von Altären verbunden. Der Stil der Internationalen Gotik kam Anfang des 15. Jahrhunderts nach Polen. Seien Zentren waren vor allem Krakau, Breslau, Thorn und Danzig. In Kleinpolen entwickelt sich die sogenannte Krakauer Schule der gotischen Malerei. Beliebtes Motiv der Krakauer Schule waren die Hodegetria, unter anderem in dem Krakauer Dominikanerkloster zu finden, und die Beweinung Christi, unter anderm in Chomranice zu finden. Weiter bedeutende Gemälde der Krakauer Schule sind die Misericordia Domini von Zbylitowska Góra, die Heilige Martha, Agnes und Klara von Sandomierz, das Dominikaner Triptychon vom Meister der Dominikanerpassion, das Augustiner-Polyptychon von Nicolaus Haberschrack, das Johannes-Polyptychon, das Dreifaltigkeits-Triptychon (alle aus Krakau), das Olkusz-Polyptychon und die Mariahimmelfahrt von Jan Wielki, der Stanislausaltar von Stare Bielsko sowie die Marias Familie von Ołpiny. In Großpolen war die Sacra Conversazione oft Gegenstand der Tafelbildmalerei, so zum Beispiel im Gemälde Madonna mit Kind, heiliger Felicitas und heiliger Perpetua. Die gotische Malerei in Schlesien stand unter starkem böhmischen Einfluss. Zu ihren bekanntesten Tafelbildern zählen die Glatzer Madonna, die Schönauer Dreifaltigkeit, die heilige Anna von Striegau, Verkündung-Polyptychon mit Einhorn, die Altäre der heiligen Hedwig und der heiligen Barbara, Madonna in der Kammer (alle in Breslau) sowie zahlreiche weitere Tafelbilder aus den Breslauer Magdalenen-, Elisabeth- und Barbarakirche. Die gotische Malerei in Pommern und Preußen stand unter starkem norddeutschen und insbesondere niederländischem Einfluss. Zu ihren bekanntesten Tafelbildern zählen das Graudanzer Polyptychon aus Graudenz, das Thorner Polyptychon aus Toruń, das Winterfeld-Diptychon aus der Danziger Marienkirche, Thorner Passion aus Thorn, Großer Ferber Altar, Kleiner Ferber Altar und Jerusalem Altar sowie Das Jüngste Gericht von Hans Memling, alle aus der Danziger Marienkirche.
Die Bildhauerkunst als Ausschmückung von Sakralbauten entwickelte sich in der Frühgotik vor allem in Schlesien, so zum Beispiel in den Kirchenportalen in Altenburg, der Ostseite des Breslauer Doms, den Kirchenportalen des Klosters Trebnitz. Als Beispiele des Übergangs zwischen Romanik und Gotik können die Portale, Schlusssteine, Kragträger, Säulenkapitellen, Friesen und Fassaden der Kreuzkirche in Breslau, Peter und Paul Basilika in Strzegom, die Ostfassade und die Innendekoration des Breslauer Rathauses, die Fassaden und die Innendekoration der Marienburg in Malbork, die Kragträger der Marienkirche auf dem Sande in Breslau, die Portale und Kragträger der Erzkathedrale von Gnesen, die Innenausstattung der Krakauer Marienkirche und die Johanneskirche in Radłów dienen. In Kleinpolen ist die gotische Ausgestaltung des Kapitelhauses des Dominikanerklosters erhalten.
Neben den Plastiken, die der Ausschmückung von Sakralbauten dienten, hat sich in der Gotik auch die freistehende Plastik entwickelt. Das weltweit größte gotische Kunstwerk der Holzschnitzkunst ist der Krakauer Hochaltar in der Krakauer Marienkirche von Veit Stoß. In derselben Kirche hat Veit Stoß auch das nach ihm bekannte Kruzifix hinterlassen sowie in der Heilig-Kreuz-Kapelle der Wawel-Kathedrale das Grabmal Kasimir IV. Zu den weiteren bedeutenden gotischen Plastiken zählen die Figur der Salomea im Mariendom in Glogau, die Pietà aus Leubus in Lubiąż, das Szamotuły Kruzifix in der Marienbasilika in Szamotuły, das Cammin Kruzifix im Johannesdom in Cammin, das Kruzifix in der Corpus Christi Kirche in Breslau und die Figuren in dem Krakauer Klarissenkloster sowie dem dortigen Karmelitinnenkloster. Auf dem Gebiet des Ordenstaats entstanden zahlreiche Schreinmadonnas. In Schlesien und Pommern wurden zahlreiche Madonnen auf Löwen geschafften, unter anderem in der Breslauer Martinskirche, in Skarbimierz und in Lubieszyn. Zu nennen ist weiter das Ciećmierz Triptychon aus der Stettiner Jakobskathedrale. In ganz Polen waren sogenannte Schöne Madonnen besonders beliebt. Die steinerne Thorner Schöne Madonna ist seit dem Zweiten Weltkrieg verschollen. Erhalten geblieben sind die steinerne Breslauer Schöne Madonna, die Danziger Schöne Madonna aus der Danziger Marienkirche, sowie die hölzerne Krużlowa Schöne Madonna. Ein weiteres beliebtes Motiv war die Pietà, unter anderem die Krakauer Pietà aus der Krakauer Barbarakirche, die Breslauer Pietà aus der Breslauer Marienkirche auf dem Sande und die Danziger Pietà aus der Danziger Marienkirche. Gotische Grabmäler und Grabplatten sind in der Wawel-Kathedrale, neben dem bereits erwähnten Grabmal Kasimir IV. vor allem das Grabmal Ladislaus I. und das Grabmal Kasimir III. des Großen, erhalten. In Schlesien sind zahlreiche gotische Grabmäler der schlesischen Piasten in dem Kloster Grüssau, dem Kloster Heinrichau, dem Oppelner Piastenschloss und der Breslauer Vinzenzkirche mit der Grabplatte Heinrich II. von Polen und der Breslauer Kreuzkirche mit dem Sarkofag Heinrich IV. des Gerechten. Gotische Taufbecken sind in Elbinger Nikolauskirche, der Liegnitzer Peter und Paul Kathedrale, dem Kolberger Dom sowie der Breslauer Marienkirche auf dem Sande. In Breslau befinden sich auch zwei gotische Sakramentshäuser von Jodokus Tauchen, eines in der Magdalenenkirche und eines in der Elisabethkirche. Gotische Chorgestühle sind unter anderem in der Pelpin Kathedrale, der Thorner Marienkirche und der Danziger Dreifaltigkeitskirche erhalten.
Auch das Goldschmiedehandwerk blühte während der Gotik in Polen, insbesondere während der Regierungszeit von Kasimir dem Großen in der Mitte des 14. Jahrhunderts. König Kasimir stiftete zahlreiche goldene liturgische Gefäße für die Kirchen in ganz Polen, wobei insbesondere die Messgefäße der Kirchen in Trzemeszno, Stopnica und Kalisz sowie die Reliquienbüste des heiligen Sigismund der Płocker Kathedrale zu erwähnen sind. Bedeutendster Goldschmied der Spätgotik in Polen war Marcin Marciniec, der unter anderem die Reliquienbüste des heiligen Stanislaus, das Zepter der Krakauer Akademie und die von Friedrich Jagiello gestifteten Reliquienschreine für die Gnesner Erzkathedrale schuf. Danziger Goldschmiede schufen den Reliquienschrein der heiligen Barbara. Bedeutende gotische liturgische Goldgefäße und Monstranzen wurden für die Krakauer Marienkirche sowie für die Kirchen bzw. Klöster in Miechów, Abtei Tyniec, Wieliczka, Niepołomice, Staniątki, Posen und Tschenstochau geschaffen. Zahlreiche weitere gotische Reliquienschreine wurden für die Kirchenschätze der Kathedralen in Krakau und Gnesen geschaffen.
Während des Übergangs von der Spätgotik zur Frührenaissance kamen bedeutende Künstler aus dem deutschen Raum, insbesondere aus Nürnberg, wie Veit Stoß, Stanislaus Stoß, Hans Dürer, Jörg Huber, Peter Vischer der Ältere, Peter Vischer der Jüngere und Georg Pencz kamen an den Hof der polnischen Könige auf dem Wawel in Krakau oder wurden von diesem unmittelbar beauftragt. Bekannteste polnische Künstler der Spätgotik waren Marcin Czarny, Nicolaus Haberschrack, Jan Polack, Adam aus Lublin, Michael aus Działdowo sowie die Anonymen Meister der Verkündigung von Jodłownik, Meister des Dominikaner-Triptychon, Meister des Dreifaltigkeits-Triptychon. Gotische Kunst wird in Polen unter anderem von den Nationalmuseen in Warschau, Krakau (Erasmus-Ciołek-Bischofspalast, Bibliothek der Fürsten Czartoryski), Danzig, Breslau, Posen und Stettin, dem Diözesanmuseum in Pelplin sowie dem Museum im Krakauer Wawelschloss gesammelt und ausgestellt.
Renaissance
Zentrum der polnischen Renaissance war die damalige Hauptstadt Krakau, insbesondere der Königshof auf dem Wawel, sowie Vilnius, das die zweite Hauptstadt des Jagiellonenreichs war. Die italienische Renaissance kam sehr früh nach Polen. Zwischen 1468 und 1470 kam der italienische Humanist Callimachus an den Krakauer Königshof von Kasimir IV. und brachte die Ideen der italienischen Renaissance nach Polen. Kasimir beauftragte Callimachus mit der Erziehung seiner Söhne im Geist des Humanismus, von denen der Älteste Ladislaus II. als König von Ungarn und Böhmen sowie drei jüngere (Johannes I. Albrecht, Alexander I. und Sigismund I. der Alte) nacheinander zwischen 1492 und 1548 als Könige Polen-Litauen regierten. Die Regentschaft der Söhne Kasimir IV. gilt als Zeitalter der Renaissance in Polen und gleichzeitig als dessen Goldenes Zeitalter in Kunst, Kultur und Politik. Sigismund, der als Jüngster zunächst keine Aussicht auf den polnisch-litautischen Thron hatte, ging um 1495 an den Königshof in Prag und Ofen seines Bruders Ladislaus, der ihn mit dem Herzogtum Glogau, Herzogtum Troppau und schließlich mit ganz Schlesien belehnte. In der ungarischen Hauptstadt wurde er auf eine Gruppe von Renaissance-Künstlern und Architekten unter der Führung von Francesco Fiorentino aus Florenz aufmerksam. Als das gotische Königsschloss auf dem Wawel in Krakau 1499 abbrannte, konnte er seine Mutter und Königswitwe Elisabeth von Habsburg überzeugen, die Florentiner beim Wiederaufbau zu engagieren.
Als Francesco Fiorentino mit seinen Schülern 1501 in Krakau eintraf, verstarb Johannes I. Albrecht und Francesco Fiorentino wurde zunächst mit der Errichtung des Grabmals für den verstorbenen König in der nach diesem benannten Kapelle in der Wawel-Kathedrale beauftragt. Das Grabmal Johannes I. Albrecht, das Francesco Fiorentino im Stil Bernardo Rossellinos schuf, gilt als erstes Kunstwerk der italienischen Hochrenaissance in Polen. Die Grabplatte selbst wurde jedoch von den Schülern Veit Stoß gefertigt und weist noch deutlich Merkmale der Spätgotik auf. Nachdem Sigismund 1506 König von Polen-Litauen wurde, beauftragte er ihn zusammen mit Eberhard Rosemberger beim Umbau des Wawel-Schlosses im Renaissance-Stil der Toskana. Der Nordostflügel des Schlosses mit seinen Plastiken wurde von Francesco Fiorentino und seiner Werkstatt, unter anderem seinem Sohn Jan Fiorentine, gestaltet. Er blieb bis zu seinem Tod 1516 der führende Renaissance-Künstler in Polen. Sigismund heiratete 1518 die Prinzessin von Mailand, Bari und Rosano Bona Sforza. Zusammen mit dem Hof von Bona Sforza kamen zahlreiche italienische Künstler und Architekten aus Florenz, Padua und Mailand nach Krakau, wo sie ihre eigenen Werkstätten gründeten. Zu den bekanntesten dieser Künstler zählten Mateo Gucci, der unter anderem an der Alten Synagoge in Kazimierz und auf dem Wawel-Schloss arbeitete, Giovanni Cini, der unter anderem am Renaissance-Altar der Wawel-Kathedrale und der Villa Decius in Krakau arbeitete (Grabmal Stanisław Oleśnickis im Posener Dom, Grabmal Krzysztof Szydłowieckis in der Martinskirche in Opatów, Renaissancealtar in Zator sowie zahlreiche Bildwerke in Vilnius, die nicht mehr erhalten sind), Filippo Fiesole, Antonio Fiesole, Niccolò Castiglione, Giovanni Soli und Bernardino Zanobi de Gianotis (Grabmal Stanisław und Janusz III. in Johanneskathedrale in Warschau), die zahlreiche Renaissance-Grabmäler und Altäre in Krakau, Płock, Vilnius und Warschau schufen, Giovanni Battista Veneziano, der vor allem in Płock und Warschau tätig war, Giovanni Maria Padovano, der vor allem in Krakau und Posen tätig war (Ziborium in der Krakauer Marienkirche, Grabmal Piotr Gamrats in der Wawel-Kathedrale, Grabmal Stanisław Oleśnickis im Posener Dom, Grabmal Mikołaj Dzierzgowskis in der Gnesner Erzkathedrale, Grabmäler von Jan Amor Tarnowski Barbara z Tęczyńskich Tarnowskis in der Marienbasilika in Tarnów, Grabmal Jan Kamienieckis im Krosnoer Franziskanerkloster), und insbesondere Bartolommeo Berrecci, ein Schüler Andrea Ferruccis, der vor allem auf dem Wawel und in Krakau tätig war, wo er den Renaissance-Umbau des Schlosses nach Francesco Fiorentino zusammen mit Benedikt von Sandomierz vollendete und die Sigismund-Kapelle an der Wawel-Kathedrale mit den Grabmälern der letzten Jagiellonen schuf, die als formtreustes Beispiel der italienischen Renaissance außerhalb Italiens gilt. Berreccis Sigismundkapelle wurde zum Vorbild für zahlreiche weitere Renaissance-Kapellen in ganz Polen-Litauen, unter anderem für die Vasa-Kapelle der Wawel-Kathedrale, die Myszkowski-Kapelle der Krakauer Dominikanerkirche und die Boim-Kapelle in Lemberg. Weitere Werke Berreccis und seiner Schüler sind das Lamento in der Martinskirche in Opatów, das Baldachim des Grabmal Ladislaus I., das Grabmal Piotra Tomicki und das Grabmal Jan Konarskis in der Wawel-Kathedrale, das Grabmal Jan Lubrańskis im Posener Dom und das Grabmal Mikołaj Szydłowieckis in der Sigismundkirche in Szydłowiec. Jan Michałowicz war ein polnischer Bildhauer und Architekt, der im Stil der italienischen Renaissance zahlreiche Grabmäler schuf, unter anderem von Filip Padniewski und Andrzej Zebrzydowski in der Zebrzydowski-Kapelle der Wawel-Kathedrale. Der Breslauer Sebastian Tauerbach und der Krakauer Hans Snycerz schnitzten die Wawel-Köpfe an der Decke des Abgeordnetensaals auf dem Wawel. Zur bürgerlichen Renaissance-Kunst zählt das Grabmal Seweryn Boners, des königlichen Bankiers von Sigismund I. dem Alten, in der Krakauer Marienkirche. Es geht auf die Werkstatt von Peter Vischer der Ältere zurück und wurde von Stanisław Samostrzelnik und Peter Flötner entworfen.
In der Renaissance-Malerei war der Mönch Stanisław Samostrzelnik in Krakau und im Kloster Mogila aktiv, wo er zahlreiche Fresken und Miniaturen schuf. Sein Stil wird als Übergang von der Spätgotik zur Renaissance beschrieben. Pietro Veneziano malte das Hauptbild des Renaissance-Altar der Wawel-Kathedrale, heute in der Marienkirche in Bodzentyn. Den Altar der Sigismundkapelle auf dem Wawel schufen die Nürnberger Hans Dürer, Peter Flötner, Georg Pencz und Pankraz Labenwolf. Sigismund II. August bestellte um 1550 in Brüssel insgesamt ca. 170 Wandteppiche für das Wawel-Schloss, die unter anderem von Pieter Coecke van Aelst geschaffen wurden. Weitere Wandteppiche wurden bei Jacob van Zeunen für die Wawel-Kathedrale bestellt. Für den Krakauer Königshof wurden auch weitere Werke bedeutender Renaissancekünstler im Ausland bestellt, unter anderem bei Lucas Cranach dem Jüngeren. Im Norden und Westen Polens und dem polnischen Lehen Herzogtum Preußen sowie in Schlesien, dass während der Renaissance zu Böhmen gehörte, und Pommern, das brandenburgerisch bzw. selbständig war, hielt die Reformation in Form des Augsburgerischen Bekenntnisses Einzug. Die Kunst dort folgte anders als in Süd- und Ostpolen nicht dem italienischen, sondern dem niederländischem Vorbild. Anstelle von üppigen Grabmälern sind schlichte Renaissance-Epitaphien in den Kirchen Danzigs oder Breslaus erhalten.
In der Renaissance entwickelte sich auch die Goldschmiedekunst in Polen-Litauen weiter. Bekanntestes Beispiel ist das Reliquiar des heiligen Stanislaus aus dem Kathedralschatz der Wawel-Kathedrale.
Renaissance Kunst wird in Polen unter anderem von den Nationalmuseen in Warschau, Krakau (Europeum), Danzig, Breslau, Posen und Stettin, dem Czartoryski-Museum sowie dem Museum im Krakauer Wawelschloss gesammelt und ausgestellt.
Manierismus
Der Übergang von der Renaissance zum Manierismus fällt in Polen mit der Regierungszeit Sigismund II. August zusammen, der Übergang vom Manierismus zum Frühbarock fällt dagegen in die frühe Regentschaft von Sigismund III. Vasa. Die Blütezeit des polnischen Manierismus stellen die Jahre der kurzen Herrschaft Heinrich Valois und der längeren Regierungszeit Stephan I. Báthory dar. Nachdem in der Renaissance Krakau das kulturelle Zentrum von Polen-Litauen war, entwickelten sich während des Manierismus drei regional verschiedene Kunststile. In Krakau, Lemberg und anderen Städten Kleinpolens sowie Posen dominierte weiterhin die Italiener, insbesondere die Künstler aus der Toskana und den Norditalienischen Städten, deren Stil sie nach Kleinpolen brachten. Im Norden Polens, insbesondere in Danzig, Elbing und Thorn dominierte der niederländische Manierismus, der von Künstlern aus den Niederlanden, Flandern und Norddeutschland ins Land gebracht wurde. In der Gegend um Lublin waren auch vor allem italienische Künstler tätig, allerdings entwickelten sie einen eigenen polnischen Stil des Maniernismus, der eine Mischung aus italienisch und niederländischem Stil gelten kann und als Lubliner Renaissance bezeichnete wird.
In der Zeit des Manierismus waren ebenfalls die italienischen Bildhauer in Polen führend, allen voran Santi Gucci, ein enger Verwandter des Renaissance-Künstlers Mateo Gucci – möglicherweise dessen jüngerer Bruder, am Krakauer Königshof und Paolo Romano, der in Lemberg tätig war. Santi Gucci, der vor allem für vom Krakauer Königshof, allen voran Sigismund II. August, Anna Jagiellonica und Stephan I. Báthory engagiert wurde, richtete seine Werkstatt in Pińczów ein. Er baute in der Sigismund-Kapelle in der Wawel-Kathedrale das Doppelgrabmal Sigismund I. und Sigusmund II. aus. In der gleichen Kapelle errichtete er auch das Grabmal Anna Jagiellonicas. Ebenfalls in der Wawel-Kathedrale schuf er in der Marienkapelle das Grabmal Stephan I. Báthorys sowie die ganze Innenausstattung der Kapelle. Zudem war Santi Gucci für Spytek Wawrzyniec Jordan tätig, für den er dessen Grabmal in der Katherinenkirche in Kazimierz schuf, sowie für verschiedene Magnatenfamilien für die er Familiengrabmäler schuf. Hieronimus Canavesi aus Mailand war ebenfalls ein italienischer Bildhauer, der für den polnischen Königshof in Krakau arbeitete. Er schuf das Grabmal Stanisław Maleszewskis in der Krakauer Dominikanerkirche sowie für die Posener Magnatenfamilie Górka das Grabmal im Posener Dom. Im derselben Kirche befindet sich das ebenfalls von ihm stammende Grabmal des Bischofs Adam Konarski. Ihm wird auch das Grabmal Jakub Rokossowski in Szamotuły zugerechnet. Hieronimus Canavesi Stil wird als Zwischenform zwischen italienischer Renaissance und niederländischem Manierismus beschrieben. Baltazar Kuncz war in Krakau und Kleinpolen tätig, wo er zahlreiche manieristische Altäre schuf, unter anderem in den Krakauer Kirchen Sankt Markus, Sankt Anna und der Heiligkreuz sowie das Chorgestühl der Fronleichnamkirche in Kazimierz. Außerhalb Krakaus arbeitete er auch im Klarissenkloster Stary Sacz, der Johanneskirche in Skalbmierz, in Szydłowiec und Kurozwęki. Als Beispiel eines manieristischen Altars in Kleinpolen kann der Hauptaltar in der Fronleichnamkirche in Biecz gelten. Die Schüler von Jan Michałowicz, Jan Biały und Sebastian Czeszek, brachten den Krakauer Stil des Renaissance-Grabmals in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts nach Lemberg und Umgebung, wo sie unter anderem das Grabmal Katarzyna Ramułtow schufen. Ein Vertreter der bürgerlichen Bildhauerkunst war der Krakauer Architekt Gabriel Słoński, der zeitweise auch zum Bürgermeister der Stadt gewählt wurde. Von ihm sind zahlreiche Renaissance und Manierismus Portale an Krakauer Bürgerhäusern erhalten. Zur bürgerlichen Kunst zählen auch die von den Schülern Santi Guccis in der Krakauer Marienkirche geschaffenen Grabmäler der Montelupi und der Cellari, italienischer Kaufmannsfamilien, die sich in Krakau niedergelassen hatten. In derselben Kirche befindet sich das manieristische Chorgestühl von Fabian Möller. Der graubündner Bildhauer Fodige Gaspare war in Chęciny und Umgebung tätig. Im Norden Polens, insbesondere in Danzig, war der aus Flandern stammende Bildhauer und Architekt Willem van den Blocke tätig, der den flämisch und niederländisch geprägten Manierismus in Nordpolen in der Bildhauerkunst ausbreitete. Willem van den Blocke schuf in der Danziger Marienkirche das Epitaph Edward Blemkes und das Epitaph der Brandes, in der Elbinger Nikolauskirche das Epitaph Valentin Bodeckers, in der Thorner Marienkirche das Epitaph der Stroband, das Grabmal der Koss im Dom zu Oliva, das Grabmal Marcin Berzewic in Lisnowo (1939 zerstört), das Kenotaph der Báthory in der Andreaskirche in Barczewo, das Grabmal Piotr Tarnowskis in der Marienkirche in Łowicz sowie das Grabmal Stanisław Pius Radziwiłłs in der Franziskuskirche in Vilnius. Grabmäler in den Kathedralen von Uppsala, Linköping und Odense wurden von ihm geschaffen. Daneben gehen auch zahlreiche Portale bürgerlicher Häuser in Danzig und Thorn auf Willem van den Blocke zurück. Auch Willems Sohn Abraham van den Blocke war ein Danziger Bildhauer. Seine Werke trugen Anfangs ebenfalls die Züge des Manierismus. Sein Hauptwerk ist jedoch bereits vom Frühbarock geprägt.
Zwei weitere Söhne Abraham van den Blocke waren in Danzig als Maler tätig, Izaak van den Blocke und David van den Blocke. Beide waren Schüler des aus den Niederlanden stammenden Hans Vredeman de Vries, der Ende des 16. Jahrhunderts in Danzig tätig war. Izaak van den Blocke vollendete das Werk Hans Vredeman de Vries an den 25 Deckengemälden im Roten Saal des Rechtstädtischen Rathauses, von denen die Allegorie des Danziger Handels die bekannteste ist. Daneben schuf Izaak van den Blocke zahlreiche weitere Deckengemälde in den Danziger Bürgerhäusern. Anton Möller war ein weiterer Vertreter des Manierismus in Danziger Malerei. Auch er schuf Deckengemälde für das Rechtstädtische Rathaus, den Artushof, die Katharinenkirche, Marienkirche und zahlreiche Patrizierhäuser in Danzig sowie einige Porträts, unter anderem das Modell der Welt und der Danziger Gesellschaft, den Bau des Tempels das Jüngstes Gericht, die Almosen-Tafel und das Epitaph Jacob Schmidts. Am Krakauer Königshof war der Breslauer Martin Kober als Porträtmaler der wechselnden polnisch-litauischen Königsfamilien am Ende des 16. Jahrhunderts tätig. Zu seinen bekanntesten Porträts zählen die von Stephan I. Báthory, Sigismund III. Vasa, Anna Jagiellonica sowie des Kronprinzen Ladislaus IV. Vasa. In Lemberg war der polnische Maler armenischer Herkunft Szymon Boguszowicz tätig, der ebenfalls hauptsächlich Porträts und Schlachtenbilder malte. Seine Bilder befinden sich heute hauptsächlich in Moskau und der Ukraine. Zu den bekanntesten gehört die Schlacht von Kluschino.
Barock
Auch der Barock kam aus Italien nach Polen. Die Kulturepoche des Barock lässt sich in Polen-Litauen in drei Abschnitte einteilen. Der Frühbarock beginnt im ausgehenden 16. Jahrhundert mit der Regierungszeit Sigismund III. Vasa und umfasst auch die Regierungszeiten seiner beiden Söhne, weshalb er auch als Vasa-Stil bezeichnet wird. Dabei überlappen sich Frühbarock und Manierismus. Während Sigismund III. Vasa, der der Gegenreformation und insbesondere den Jesuiten zugeneigt war, von Anfang seiner Regentschaft den Frühbarock förderte und entsprechende Künstler aus der italienischen Schweiz und Rom nach Polen-Litauen holte, war die Königinwitwe seines Vorgängers Anna Jagiellonica weiterhin dem Manierismus und ihrem lieblingskünstler der Epoche Santi Gucci treu. Die unterschiedlichen Stile unterschieden sich auch geographisch. Nachdem ein Teil des Renaissance-Schlosses auf dem Wawel 1596 durch einen Brand beschädigt war, verlegte Sigismund III. Vasa die polnisch-litauische Hauptstadt nach Warschau. Seinen neuen Regierungsitz baute er konsequent im Stil des Frühbarock aus, genauso wie der reiche Adel, der ihm von Krakau nach Warschau nachzog seine Paläste in Warschau in diesem Stil baute. Dagegen blieb Nordpolen, insbesondere Danzig, Elbing und Thorn, dem niederländischen Manierismus treu – wenn auch einzelne Danziger Künstler sich immer mehr vom Frühbarock inspirieren ließen, so zum Beispiel Abraham van den Blocke beim Neptunbrunnen – und in der Gegend um Lublin entwickelte sich Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts ein eigener Stil, der als Lubliner Renaissance bezeichnete wird.
Der Hochbarock fällt mit den Regierungszeiten Michael I. und Johann III. Sobieski in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zusammen und wird daher auch als Sobieski-Stil bezeichnete. In dieser Zeit setzte sich der Barock in ganz durch. Anders als der Frühbarock, der vor allem italienischen Vorgaben – hier vor allem der Bidhauerkusnt Gian Lorenzo Berninis – folgte, war der Hochbarock stark vom französischen Barockstil beeinflusst.
Der Spätbarock fällt ist mit den sächsischen Wettinern August II. dem Starken und August III. sowie deren Gegenspieler Stanislaus I. Leszczyński verbunden. Allerdings bevorzugten die Wettiner bereits den Rokoko-Stil, in Polen-Litauen auch Wettiner- oder sächsischer Stil genannt, der mit dem Spätbarock zeitlich zusammenfällt.
Ein wichtiges Ereignis für die frühbarocke Bildhauerkunst in Polen war die Anlegung von Marmorsteinbrüchen in Dębnik unweit von Krakau im ausgehenden 16. Jahrhundert. Der hier gewonnene schwarze, weiße und gelbe Marmor wurde für viele barocke Statuen in ganz Polen verwendet. So ist zum Beispiel die Innenaustattung der für die drei Könige der Vasa-Dynastie angelegte Vasa-Kapelle in der Wawel-Kathedrale und die Zbarski-Kapelle der Krakauer Dominikanerkirche aus Dębniker-Marmor. Als Bildhauer und Projektant dieser Kapellen sind insbesondere die Italiener bzw. Tessiner Giovanni Trevano, Matteo Castelli, Constantino Tencalla und Sebastian Sala hervorzuheben. Weitere charakteristische Grabmäler des Frühbarock aus Dębniker-Marmor sind das Grabmal Andrzej Trzebickis in der Krakauer Peter-und-Paulkirche, das Grabmal Piotr Tylickis in der Wawel-Kathedrale oder das Grabmal Piotr Opalińskis in der Zirker Marienkirche in Sieraków. Giovanni Battista Falconi war ein Stuckateur am Hof der Vasa-Könige, der unter anderem in der Vasa-Kapelle, der Krakauer Peter-und-Paulkirche, Kazimierzer Issak-Synagoge, der Sebastian-Kapelle des Krakauer Kamaldulenserklosters, der Zamośćer Kollegiatkirche, der Lubliner Stanislausbasilika, der Krosnoer Franziskanerkirche, der Klimontówer Josephskirche, der Schlosskapelle der Burg Podhorce, am Schloss Baranów Sandomierski, am Schloss Nowy Wiśnicz und der Rzeszówer Heiligkreuzkirche tätig war. Die wohl erste frühbarocke Plastik in Polen ist der Danziger Neptunbrunnen von Abraham van den Blocke mit der Hauptfigur von den aus Flandern stammenden Peter Husen und Johann Rogge. Abraham van den Blocke, der zunächst wie sein Vater im Stil des Manierismus schuf, gilt als wichtigster Vertreter des Frühbarocks unter den Danziger Bildhauern. Er schuf den Hauptaltar der Johanneskirche sowie die detailreiche Ausschmückung der Fassaden des Arturhofs, des Großen Zeughaus, des Goldenen Tors, des Goldenen Hauses und des Hauses der Äbte in Pelplin sowie vollendete zahlreiche Aufträge aus ganz Nordpolen, die sein Vater erhalten hatte. Das Epitaph Marchese Bonifazio Orias und das Grabmal Simon und Judith Bahrs in der Danziger Marienkirche gehen auch auf ihn zurück. Das wohl bekannteste frühbarocke und gleichzeitig erstes weltliches Denkmal Warschaus ist die Sigismundssäule von Agostino Locci und Constantino Tencalla, die Ladislaus IV. Vasa zu Ehren seines Vaters Sigismund III. Vasa vor dem Warschauer Königsschloss aufstellen ließ.
In der Zeit des Hochbarocks waren die gebürtigen Römer Giovanni Battista Gisleni (Hauptaltar der Wawel-Kathedrale, Vasa-Obelisk in Wyszków, zahlreiche Grabmäler in den Kathedralen in Krakau und Vilnius) und Giovanni Francesco Rossi (Büsten des Königspaars Johann II. Kasimirs und Luisa Maria Gonzagas, das Grabmal Piotr Gembickis in der Wawel-Kathedrale sowie zahlreiche Grabmäler in der Wilnaer Kathedrale) die führenden Bildhauer in Polen-Litauen. Der tessiner Stuckateur Baldassare Fontana war in Krakau tätig, wo er unter anderem in der Annakirche, Karmeliterkirche und Klarissenkirche sowie in der Altsandezer Klarakirche arbeitete. Der gebürtige Danziger Andreas Schlüter war ebenfalls für den polnischen Königshof in Warschau und Wilanów tätig, wo er unter anderem die Statuen für den Wilanów-Palast, das Epitaph Adam Konarskis im Frauenburger Dom, das Grabmal der Sobieskis in Żółkiew, das Tympanon am Krasiński-Palast, den Hauptaltar der Czerniakówer Antoniuskirche, das Kruzifix der Węgrówer Antoniuskirche und das Grabmal Jan Małachowskis in der Wawel-Kathedrale schuf. Jerzy Hankisz war als Schnitzer in Krakau aktiv, wo er unter anderem den Hauptaltar der Kirche Maria auf dem Sande schnitzte. Giuseppe Simone Bellotti schuf in der Krakauer Vorstadt in Warschau die Säule der Passauer Madonna mit Kind.
Während des Spätbarocks war Francesco Placidi der bedeutendste Bildhauer in Polen-Litauen. Auf ihn gehen die Grabmäler Johann II. Sobieski und Marie Casimire Louise de la Grange d’Arquien sowie Michael I. und Eleonore von Österreich in der Wawel-Kathedrale zurück. Er war auch verantwortlich für den Umbau der Lipski-Kapelle in der Wawel-Kathedrale, zahlreiche Altäre in der Wawel-Kathedrale und Krakauer Marienkirche und den Umbau der Fassade der Krakauer Piartistenkirche. Der Jesuit Dawid Heel schuf die Figuren vor und an der Krakauer Peter-und-Paulkirche und der Krasnystawer Franziskuskirche. Antoni Frąckiewicz schnitzte die Innenausstattung des Imbramowicer Norbertanerinnenklosters, den Hauptaltar der Krakauer Johanneskirche, den Hauptaltar der Kliecer Kathedrale, die Kanzel der Krakauer Annakirche und zahlreiche Heiligenfiguren für unter anderem die Abtei Tyniec.
Während des Barock wurde auch die Orgelbaukunst in Polen-Litauen gepflegt. Barocke Orgeln sind in der Leżajsker Basilika, der Johanneskirche in Kazimierz Dolny, der Posener Jesuitenkirche, im Dom zu Oliva und im Dom zu Cammin (während des Barock schwedisch) erhalten.
Zu den frühbarocken Malern gehörten vor allem Geistliche, unter anderem der von Rubens und van Dyck stark beeinflusste Bernhardiner Franciszek Lekszycki, der den Totentanz und Altar in der Krakauer Bernhardinerkirche sowie zahlreiche Bilder in der Marienbasilika in Kalwaria Zebrzydowska, Leżajsk, Lemberg, Przeworsk, Vilnius, Warschau und Borek schuf, Krzysztof Boguszewski, der unter anderem Die Ankunft des heiligen Marin in Amiens, Das himmlische Jerusalem sowie die Die unbefleckte Empfängnis für den Posener Dom schuf, sowie der anonyme Maler des Totenrads der Krakauer Katherinenkirche. Der bedeutendste Maler des Frühbarock in Polen war jedoch der von Sigismund III. Vasa engagierte den Italiener aus Venetien Tommaso Dolabella, der zahlreiche Gemälde für den Königshof und Kirchen in ganz Polen malte. Seine Bilder mit religiöser und histortischer Thematik hängen in zahlreichen Kirchen, insbesondere im Krakauer Dominikanerkloster, im Kamaldulenserkloster Krakau, in der Krakauer Fronleichnamkirche, der Lubliner Stanislauskirche, dem Bischofspalast Kielce sowie auf dem Wawel, von denen die Schlacht bei Lepanto die bekannteste ist. Seine Schüler Astolf Vagioli und Zachariasz Dzwonowski vollenden viele Arbeiten von Tommaso Dolabella, unter anderem acht Gemälde für das Krakauer Augustinerkloster. Insbesondere in Krakau wurde die gotische Innenausstattung der Kirchen durch monumentale barocke Gemälde ersetzt, so zum Beispiel in den barockisierten Kirchen Sankt Katherina und Corpus Cristi in Kazimierz oder auch im Kloster Pelplin. In Nordpolen waren während des Frühbarocks Herman Han (tätig insbesondere für die Klöster Pelplin und Oliva), der Porträtmaler der Danziger Patriziariats Andreas Stech, Daniel Frecher, Daniel Schultz und Bartholomäus Strobel tätig, deren Kunst sich um die Mitte des 17. Jahrhunderts stark an den Werken Rembrandt van Rijn orientierte. Die letzteren beiden Genannten waren auch zeitweise als Hofmaler in Warschau engagiert.
Nach den zahlreichen Kriegen während der Regierungszeit Johann II. Kasimir begann der Wiederaufbau im Stil des Hochbarocks. Während dieser Zeit schritt die Barockisierung der gotischen Kirchen in Polen-Litauen weiter voran, beispielsweise des Klosters Miechów. Zum bedeutendsten Maler am Hof Johann III. Sobieskis stieg Jerzy Siemiginowski-Eleuter auf, der zahlreiche Porträts der Königsfamilie Sobieskis sowie die allegorischen Fresken in der neuen Residenz Wilanów bei Warschau sowie in der Krakauer Annakirche schuf. Weitere bedeutende Maler am Hof von Sobieski waren die Italiener Jan Tricius und Michelangelo Palloni (auch tätig für die Kathedrale in Wilna, insbesondere die Fresken der Kasimir-Kapelle, die Wilnaer Peter-und-Paulkirche, das Kamaldulenserkloster Warschau, das Kloster Łowicz, das Kloster Pažaislis sowie mehrere Kirchen in Węgrów), der gebürtige Warschauer Jan Reisner, der Schwede Karl Dankwart (auch tätig für die Krakauer Annakirche), der Österreicher Martino Altomonte (auch tätig für das Kloster Heiligelinde und Kirchen in Krakau und Vilnius sowie in den Residenzen Sobieskis in Podhorce sowie Żółkiew) sowie die Franzosen Claude Callot und François Desportes. Immer beliebter wurde die Sargmalerei, bei der zum Zweck der Totenfeier Porträts des Verstorbenen in Form der Querschnittsform des Sarges gemalt wurden. Diese wurden entweder bei der Bestattung an den Sarg befestigt oder in der Kirche, in der der Verstorbene bestattet worden ist, aufgestellt. In Schlesien, das während des Hocharocks zum habsburgerischen Böhmen gehörte, war unter anderem Michael Willmann aktiv, der unter anderem die Deckenfresken in den Klöstern Leubus und Grüssau schuf. Wojciech Bobowski war am Sultanshof in Istanbul, Teodor Lubieniecki unter anderem am preußischen Königshof in Berlin und Marcin Teofilowicz in Tirol tätig.
Zu den spätbarocken Malern, die bereits vom Rokoko beeinflusst waren, zählten Szymon Czechowicz und Tadeusz Kuntze. Der Kunstgeschmack am polnischen Königshof ging vom Hochbarock fast nahtlos in den Rokoko über, so dass in Warschau relativ wenig in Stil des Spätbarock gemalt wurde. In der Provinz und auch im böhmischen Schlesien konnte sich der Spätbarock dagegen behaupten. In den Klöstern Tschenstochau, Ląd, Kloster Himmelwitz, Liebenthaler Kloster, Sagan, Heiligberg bei Gostyń sowie der Neumarkter Andreaskirche, Schömberger Heilige-Familie-Kirche und Bunzlauer Marienkirche sowie dem Schloss Rydzyna war der Breslauer Georg Wilhelm Neunhertz und in den Klöstern Leubus, Grüssau, Glatz sowie der Hirschberger Gnadenkirche Liebauer Marienkirche und der Neißer Peter-und-Paulkirche sowie der Universität Breslau der Münchner Felix Anton Scheffler als Freskenmaler aktiv. Die Aula Leopoldina der Universität Breslau wurde von Christoph Tausch, Franz Joseph Mangoldt, Johann Christoph Handke und Krzysztof Hollandt gestaltet. In Teschen-Schlesien waren Ludwik Antoni Brygierski, Wawrzyniec Cieszyński und Piotr Brygierski tätig. Der Italiener Wilhelm Italiano war in Kleinpolen tätig. Von ihm sind Fresken in Kloster Imbramowice und der Krakauer Marienkirche erhalten. In Ostpolen entwickelte sich zu dieser Zeit eine eigene Form des ukrainischen Barock und der Ikonenmalerei.
Rokoko
Der Rokoko fällt mit der Personalunion Sachsen-Polen unter den Wettinern zusammen. August II. der Starke holte viele Künstler aus Sachsen nach Polen-Litauen, die insbesondere am Königshof in Warschau tätig waren, wo August II. der Starke die Ostflanke des Königsschlosses und das Sächsisches Palais mit dem Sächsischen Garten in der Sächsischen Achse im neuen Stil ausbauen ließ.
Zur sächsischen Zeit waren die Bildhauer Johann Georg Plersch (unter anderem Grabmal Jan Tarłos in der Warschauer Jesuitenkirche, die Innenausstattung der Warschauer Visitantinnen-Kirche und Warschauer Karmelitenkirche sowie die allegorischen Figuren im Warschauer Sächsischen Garten) am Königshof in Warschau tätig. In Lemberg waren die Schnitzer und Bildhauer Maciej Polejowski (unter anderem Figuren für die Hodowicer Allerheiligenkirche, für die Lemberger Kathedrale, Sandomirer Kathedrale sowie die Włodawer Paulinerkirche), Sebastian Fesinger (unter anderem Figuren in der Lemberger Dominikanerkirche, Lemberger Trinitarierkirche, der Przemyśler Franziskanerkirche, der Boćkier Josephskirche sowie im Lemberger Lubomirski-Palast), Antoni Osiński (Figuren in der Warschauer Dominikanerkirche sowie der Leżajsker Marienbasilika) und insbesondere Johann Georg Pinsel (unter anderem Figuren für das Butschatscher Rathaus, die Lemberger griechisch-katholische Erzkathedrale, die Hodowicer Allerheiligenkirche, die Horodenkaer Marienkirche sowie der Lemberger Martinskirche) tätig, die die Lemberger Rokoko-Schule begründeten. In Krakau und Umgebung wirkten die Rokoko-Schnitzer Wojciech Rojowski und Piotr Kornecki (unter anderem Hauptaltar in der Bochniaer Nikolauskirche). In Danzig schuf der Rokoko-Bildhauer Johann Heinrich Meißner, der die Figuren an der kleinen Orgel in der Danziger Johanneskirche, der großen Orgel in der Danziger Marienkirche sowie die Rokoko-Kanzel in derselben Kirche.
Am Warschauer Königshof war unter August III. die Rokoko-Maler Anton Ignaz Hamilton (Tierszenen und Stillleben), Louis-François Marteau (Porträtmaler), Józef Meyer (unter anderem Fresken in der Lubliner Johanneskathedrale) und Johann Samuel Mock (Porträtmaler, Gemälde für das Warschauer Königsschloss und das Grodner Königsschloss, historische Gemälde, wie der Einzug August II. in Warschau sowie das Projekte für Triumpfbögen in Warschau) sowie dessen Schüler Łukasz Smuglewicz (Deckenfresken in der Zwierzyniecer Nepomukkirche und der Kuppel der Podhorcer Josephskirche sowie das erste Projekte des Tempels der Göttlichen Vorsehung) und Johann Benedikt Hoffman tätig. Die Maler Szymon Czechowicz und Tadeusz Kuntze gingen in ihrem Spätwerken vom Spätbarock zum Rokoko über.
Klassizismus
Der Übergang vom Rokoko zum Klassizismus erfolgte relativ abrupt mit dem Ende der Wettiner-Dynastie und dem Beginn der Regentschaft Stanislaus II. Augusts in den 1760er Jahren. Die erste Phase des Klassizismus fällt mit der Regierungszeit Stanislaus II. August, die mit der dritten Polnischen Teilung 1795 endete, zusammen und wird daher als Stanislaus-Stil bezeichnet. Der Klassizismus dauert danach bis in die 1820er Jahre fort, war nicht mehr der einzige Kunststil, da der Romantismus ihm seit Anfang des 19. Jahrhunderts Konkurrenz machte.
Im Stanislaus-Stil schuf der aus Frankreich stammende Bildhauer André Le Brun, der unter anderem zusammen mit dem gebürtigen Österreicher Franciszek Pinck das Denkmal Johann III. Sobieski in Warschau im Łazienki-Park und zahlreiche weitere Figuren in diesen Park sowie zahlreiche Statuen im Warschauer Königsschloss und Schloss Kozienice schuf. André Le Bruns Schüler war der Italiener Giacomo Monaldi, der ebenfalls für das Warschauer Königsschloss, den Myślewicki-Palast und die Warschauer Annakirche arbeitete.
Der wichtigste Bildhauer des späten Klassizismus in Polen war der Däne Bertel Thorvaldsen, der viele Denkmäler in Warschau, Krakau und Lemberg schuf, unter anderem das Józef-Poniatowski-Denkmal, das Nikolaus-Kopernikus-Denkmal, das Grabmal Stanisław Małachowskis in der Warschauer Heiligkreuzbasilika, das Grabmal Artur Stanisław Potockis in der Potocki-Kapelle in der Wawel-Kathedrale, das Grabmal Józef Borkowskis in der Lemberger Dominikanerkirche, das Grabmal der Kinder Fürstin Ponińska, sowie weitere Werke unter anderem auf dem Schloss Łańcut sowie Warschauer Bürgerhäusern. Schüler Thorvaldsen war Jakub Tatarkiewicz, der unter anderem das Potocki-Mausoleum sowie zahlreiche Grabmäler auf dem Powązki-Friedhof schuf. Anton Schimser und Hartmann Witwer waren in Lemberg tätig, wo sie zahlreiche Figuren für Bürgerhäuser sowie Grabmäler auf dem Lützenhofer Friedhof entwarfen.
Am Warschauer Königshof war unter Stanislaus II. August die aus Italien stammenden Maler Bernardo Bellotto, genannt Canaletto (zahlreiche Warschau- und Rom-Veduten für das Schloss Ujazdów und das Warschauer Königsschloss, unter anderem das Warschauer Panorama von Praga, sowie die Historienbilder der Einzug des Gesandten Jerzy Ossoliński in Rom im Jahre 1733 und die Wahl Stanislaus II. August zum polnischen König), Marcello Bacciarelli (Porträts der Mitglieder des Königshofs, insbesondere des Königs, sowie historische Gemälde und Wand- und Deckenfresken für das Warschauer Königsschloss und denŁazienki-Palast), der Sohn Johann Georg Plersch' Johann Gottlieb Plersch (Wandgemälde im Schloss Ujazdów, Decken- und Wandgemälde im Warschauer Königsschloss, Innenausstattung des Łazienki-Palasts, des Weißen Hauses und der Alten Orangerie im Warschauer Łazienki-Park, Wandgemälde im Nationaltheater Warschau sowie in zahlreichen Palästen um Warschau), der Porträtmaler Antoni Albertrandi und der Miniatur- und Porträtmaler Józef Kosiński.
Zu den Malern des späten Klassizismus gehörte der aus Frankreich stammende Historienmaler Jean Pierre Norblin de La Gourdaine, der neben Warschau auch auf den Schlössern Nieborów und Arkadia sowie Puławy tätig war, die Söhne Łukasz Smuglewicz' Antoni Smuglewicz (unter anderem Fresken in der Podhorcer Nikolauskirche) und Franciszek Smuglewicz (unter anderem Fresken in der Universität Vilnius), sowie dessen Schüler Józef Peszka (unter anderem Historiengemälde und zahlreiche Ansichten von Krakau), und der Aquarellmaler Zygmunt Vogel (unter anderem zahlreiche Ansichten von Warschau). Zur Wilnaer Kunstschule gehörten Jan Rustem, Józef Oleszkiewicz, Maciej Topolski und Mateusz Tokarski.
19. Jahrhundert
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, von den napoleonischen Kriegen bis zum Januaraufstand konkurrierten in der polnischen Kunst der klassische und der romantische Stil, der sich in den 1830er Jahren durchsetzte und nach dem Januaraufstand vom Positivismus und Histortismus abgelöst wurde. Um die vorletzte Jahrhundertwende dominierte der Jungendstil, der insbesondere in Galizien als Junges Polen bezeichnet wird.
Bedeutende Bildhauer des 19. Jahrhunderts waren Konstanty Hegel (unter anderem das Syrenka-Denkmal auf dem Warschauer Marktplatz und die Quadriga am Warschauer Großen Theater), Leonard Marconi (unter anderem Epitaph Frédéric Chopins in der Warschauer Kreuzkirche, Figuren an der Fassade der Lemberger Universität – damals des Galizischen Landtags, Lemberger Aleksander Fredro Denkmal heute Breslau, Krakauer Tadeusz Kościuszko Denkmal sowie Skulpturen am Warschauer Kronenberg-Palast, Lemberger Hotel Gorge, der Lemberger Galizischen Sparkasse sowie Grabmäler auf dem Lemberger Lützenhofer Friedhof), Andrzej Pruszyński (unter anderem Christus-Statue vor der Warschauer Heiligkreuzkirche, Marien-Statue vor der Warschauer Karlskirche, Statuen in der Warschauer Villa Rau und dem Warschauer Bogusławski-Palais sowie zahlreiche Grabmäler auf dem Powązki-Friedhof, dem Warschauer Evangelisch-Augsburgischer Friedhof und dem Warschauer Jüdischen Friedhof), Wacław Szymanowski (Denkmäler und Figuren im Jungendstil, insbesondere das Warschauer Chopin-Denkmal, Grabmäler auf dem Powązki-Friedhof, Figuren in dem Warschauer Romuald Traugutt Park sowie zahlreiche Grabmäler auf dem Krakauer Rakowicki Friedhof). In Krakau war auch Teodor Rygier tätig, der unter anderem das Krakauer Adam-Mickiewicz-Denkmal sowie Figuren am Krakauer Kunstpalast schuf. In Lemberg war Antoni Popiel aktiv, der unter anderem das Lemberger Adam-Mickiewicz-Denkmal, Lemberger Kornel-Ujejski-Denkmal heute in Stettin, das Tadeusz-Kościuszko-Denkmal vor dem Weißen Haus in Washington, D.C. (eine Kopie befindet sich seit 2010 vor dem Warschauer Lubomirski-Palast) sowie Figuren an der Lemberger Oper schuf. Kazimierz Chodziński schuf das Kazimierz-Pułaski-Denkmal ebenfalls vor dem Weißen Haus in Washington sowie das das Tadeusz-Kościuszko-Denkmal in Chicago. Antoni Wiwulski errichtete das Krakauer Grunwalddenkmal sowie die Dreikreuzgruppe in Vilnius. Bolesław Bałzukiewicz wirkte ebenfalls vor allem in Vilnius, wo er unter anderem das Stanisław Moniuszko Denkmal sowie zahlreiche Grabmäler auf dem Wilnaer Rosa-Friedhof schuf. Cyprian Godebski schuf unter anderem das Warschauer Adam Mickiewicz Denkmal, das Krakauer Alexander Fredro Denkmal sowie das Lemberger Artur Grottger Denkmal in der Lemberger Dominikanerkirche. Antoni Madeyski schuf das Grabmal Hedwig Anjous und das Grabmal Ladislaus III. in der Wawel-Kathedrale. Pius Weloński schuf zahlreich Skulpturen unter anderem im Krakauer Planty Park.
Die romantische Malerei entwickelte sich in Polen nach den Teilungen und behandelte meist politische oder mythologische Themen. Bekannte Vertreter des Romantismus in der polnischen Malerei waren Walenty Wańkowicz, Piotr Michałowski, Henryk Rodakowski und Artur Grottger. Bekanntester Vertreter der Akademischen Kunst war Henryk Siemiradzki. Józef Szermentowski war der wohl bedeutendste polnische Landschaftsmaler des 19. Jahrhunderts. Im Zeitalter des Positivismus dominierte die Historienmalerei, deren bekannteste Vertreter Juliusz Kossak, die Brüder Maksymilian und Aleksander Gierymski sowie Jan Matejko sein dürften. Weitere wichtige Vertreter des Realismus waren Anna Bilińska-Bohdanowiczowa, Józef Brandt, Teodor Buchholz, Józef Chełmoński, Romuald Chojnacki, Adam Ciemniewski, Jan Chrucki, Wincenty Dmochowski, Odo Dobrowolski, Tadeusz Dowgird, Emilia Dukszyńska-Dukszta, Alfons Dunin-Borkowski, Franciszek Teodor Ejsmond, Ludwik Gędłek, Ignacy Gepner, Wojciech Gerson, Henryk Grabiński, Antoni Gramatyka, Stanisław Grocholski und Jan Gwalbert Olszewski. Matejkos Schüler Józef Mehoffer und Stanisław Wyspiański entwickelten die sezessionistische Richtung Junges Polen, zu der auch Ludwik Eugeniusz Dąbrowa-Dąbrowski, Antoni Gawiński, Wojciech Jastrzębowski, Jacek Malczewski sowie Edward Okuń gehörten. Bekannte Vertreter des Impressionismus waren Stanisław Chlebowski, Jan Bohuszewicz, Jan Ciągliński, Julian Fałat, Gustaw Fierla, Marcin Kitz, Władysław Podkowiński, Józef Pankiewicz und Olga Boznańska. Zu den polnischen Expressionisten gehörten Wojciech Weiss, Leon Weissberg, Witold Wojtkiewicz, Ryszard Woźniak, Stanisław Kubicki, Konrad Krzyżanowski, Wincenty Drabik, Waldemar Cwenarski, Marian Bohusz-Szyszko und Andrzej Awsiej. Zu den Naturalisten werden Feliks Brzozowski und Janina Płoska gezählt. Als Symbolisten gelten Wlastimil Hofman, Ferdynand Ruszczyc, Kazimierz Stabrowski, Władysław Ślewiński und Witold Wojtkiewicz.
20. Jahrhundert
Die Zäsur zwischen 19. und 20. Jahrhundert in der polnischen Kunstgeschichte wird in der Regel nicht bei der Jahrhundertwende, sondern beim Ersten Weltkrieg angesetzt. Folgerichtig ist die Zwischenkriegszeit die erste und der Sozrealismus die zweite Kunstphase des 20. Jahrhunderts in Polen. Der Übergang von der Kunst des 20. Jahrhunderts zur gegenwärtigen Kunst wird ebenfalls nicht an der letzten Jahrhundertwende, sondern am Ende der Volksrepublik Polen Ende der 1980er Jahre festgemacht.
Der wohl bekannteste Bildhauer der Zwischenkriegszeit war Xawery Dunikowski, der unter anderem das Krakauer Józef Dietl Denkmal und Warschauer Amerika-Dankbarkeits-Denkmal schuf. Er war auch nach dem Zweiten Weltkrieg aktiv und schuf unter anderem das Denkmal für die Aufstände in Oberschlesien auf dem St. Annaberg, das Denkmal der Befreiung von Ermland und Masuren in Allenstein und das Denkmal für die Soldaten der Ersten Polnischen Armee in Warschau. Im Warschauer Królikarnia-Palast wurde ein Museum für seine Werke eingerichtet. Zu seinen Schülern zählten Jerzy Bandura, Zygmunt Gawlik, Józef Gosławski, Maria Jarema, Ludwik Konarzewski, Jacek Puget und Henryk Wiciński. Ludwika Nitschowa schuf unter anderem das Syrenka-Denkmal am Weichselufer.
In der Zwischenkriegszeit entwickelten sich verschiedene Kunstrichtungen. Die ersten Jahre waren vom Formismus geprägt, dessen Vertreter Leon Chwistek, Tytus Czyżewski, Henryk Gotlib, Jan Hrynkowski, Jacek Mierzejewski, Tymon Niesiołowski, Andrzej Pronaszko, Zbigniew Pronaszko, Konrad Winkler, Stanisław Ignacy Witkiewicz, August Zamoyski, Romuald Kamil Witkowski, Wacław Wąsowicz, Jerzy Zaruba, Mieczysław Szczuka, Leon Dołżycki und Ludwik Lille waren. Später dominierte der Unismus, dessen Vertreter Władysław Strzemiński, Julian Lewin, Samuel Szczekacz und Stefan Wegner waren, sowie die Gruppe Rytm, deren Vertreter Maja Berezowska, Wacław Borowski, Leopold Gottlieb, Tadeusz Gronowski, Stanisław Horno-Popławski, Zygmunt Kamiński, Felicjan Szczęsny Kowarski, Henryk Kuna, Rafał Malczewski, Tymon Niesiołowski, Stanisław Noakowski, Tadeusz Pruszkowski, Władysław Roguski, Stanisław Rzecki, Władysław Skoczylas, Zofia Stryjeńska, Zofia Trzcińska-Kamińska, Romuald Kamil Witkowski, Edward Wittig und Eugeniusz Zak. Unabhängige Künstler dieser Epoche waren Bruno Schulz, Mieczysław Szczuka und Tadeusz Makowski.
Während des Zweiten Weltkrieges wurden von Hitlerdeutschland und der Sowjetunion sehr viele Kunstschätze aus den polnischen Museen, Kirchen und Palästen geraubt oder zerstört. Viele von ihnen wie beispielsweise der Jüngling von Raffael sind bis heute nicht wieder aufgetaucht.
In der Volksrepublik war der Sozrealismus vorherrschend. Wichtige Bildhauer der Volksrepublik waren Magdalena Abakanowicz, Alina Szapocznikow, Bronisław Chromy und Alina Szapocznikow. Leon Suzin und Natan Rapaport errichteten noch in den 1940er Jahren das Denkmal der Helden des Ghettos in Warschau und Marian Konieczny das Denkmal der Helden Warschaus. Witold Cęckiewicz schuf das Krakauer Denkmal der Opfer des Faschismus, Franciszek Duszeńko das Denkmal der Opfer des KZ Treblinka, Wiktor Tołkin das Denkmal des Widerstands und des Märtyertums in Majdanek und Hanna Szmalenberg sowie Władysław Klamerus das Denkmal des Umschlagplatzes in Warschau. Kazimierz Gustaw Zemła schuf das Kattowitzer Denkmal der Schlesischen Aufständischen, Denkmal der Gefallenen-Unbesiegten auf dem Friedhof der Warschauer Aufständischen, das Denkmal der Polnischen Tat in Stettin, das Warschauer Denkmal der Schlacht bei Monte Cassino sowie das Warschauer Henryk Sienkiewicz Denkmal im Łazienki-Park.
In der Malerei war Andrzej Wróblewski der führende Vertreter des Sozrealismus. Gleichwohl entwickelten Künstler wie Piotr Potworowski, Władysław Hasior Ludwik Konarzewski, Jerzy Duda-Gracz, Zdzisław Beksiński oder Nikifor Krynicki eigene Kunstrichtungen. Zur Gruppe der Koloristen gehörten unter anderem Jan Cybis, Jan Szancenbach, Artur Nacht-Samborski und Hanna Rudzka-Cybisowa sowie zur Gruppe Krakau II unter anderem Tadeusz Kantor, Maria Jarema und Jerzy Nowosielski. Weltruhm erlangte die Polnische Schule der Plakatkunst zu der unter anderem Józef Gielniak, Jerzy Panek, Stanisław Kluska, Mieczysław Wejman, Henryk Tomaszewski, Roman Cieślewicz, Jan Młodożeniec, Waldemar Świerzy, Jan Lenica und Roman Kalarus gehörten.
21. Jahrhundert
Mittlerweile ist die Kunst wieder entpolitisiert. Die wichtigsten Gegenwartskünstler sind Wilhelm Sasnal, Rafał Bujnowski, Józef Robakowski, Paweł Althamer, Mirosław Bałka, Leszek Knaflewski, Robert Kuśmirowski, Zuzanna Janin, Krzysztof Wodiczko, Paulina Ołowska, Katarzyna Kozyra und Joanna Rajkowska. Besondere Beachtung im Ausland erfuhr der Bildhauer Igor Mitoraj mit seinen monumentalen an die antike Kunst anknüpfenden Plastiken. Zahlreiche Galerien und Museen widmen sich der Gegenwartskunst, von denen die Galeria Zachęta und das Museum für moderne Kunst in Warschau die wichtigsten sind. Letzteres soll bis 2020 ein neues Gebäude am Defiladenplatz vor dem Kulturpalast erhalten.
Ausländische Kunst in Polen
Der polnische Königshof bestellte bereits seit dem Mittelalter Kunst bei führenden ausländischen Künstlern, zunächst bei den Nürnbergern und ab der Renaissance vor allem in Italien, den Niederlanden und Flandern. Auch der reiche Adel begann seit der Renaissance eigene Kunstsammlungen wichtiger ausländischer Kunstschaffender anzulegen. So kamen Werke Leonardo da Vincis, Sandro Botticellis, Raffaels, Domenico Ghirlandaios, Bonifazio Veroneses, Lorenzo Lottos, El Grecos, Guercinos, Hans von Kulmbach, Hans Holbeins des Jüngeren, Lucas Cranachs des Älteren, Lucas Cranachs des Jüngeren, Pieter Brueghels des Jüngeren, Jan Brueghels des Älteren, Peter Paul Rubens, Jacob Jordaens, Rembrandt van Rijns, Eugène Delacroixs und vieler anderen nach Polen. Die ersten, die ihre Sammlung öffentlich zugänglich machten waren im 18. Jahrhundert die Czartoryskis, deren Museum sich heute in Krakau befindet. Viele bedeutende Kunstwerke wurden während der Schwedischen Sintflut, der Teilungszeit und insbesondere der beiden Weltkriege geraubt bzw. zerstört. Einiges konnte jedoch auch erhalten und wiedererlangt werden. Bedeutende Werke von Weltrang finden sich neben dem Krakauer Czartoryski-Museum auch auf dem Wawel, dem Krakauer Nationalmuseum, insbesondere in der Ausstellung Europeum, dem Warschauer Königsschloss, der Warschauer Sammlung Johannes Paul II. sowie dem Warschauer Nationalmuseum.

Sandro Botticelli

Leonardo da Vinci

Domenico Ghirlandaio

Bonifazio Veronese

Hans von Kulmbach

Lucas Cranach d. Ä.

El Greco

Peter Paul Rubens

Rembrandt van Rijn
Architektur

Ruinen des Lednickier Palas

Romanische Thomaskirche

Gotische Krakauer Marienkirche

Gotischer Breslauer Dom

Gotische Danziger Marienkirche

Gotische Marienburg

Renaissance Wawel-Schlosshof

Renaissance Posener Rathaus

Renaissance Villa Decius

Renaissance Sigismundkapelle

Manieristisches Schloss Krasiczyn

Manieristisches Großes Zeughaus

Manieristisches Zamośćer Rathaus

Barocke Krakauer Jesuitenkirche

Barockes Königsschloss Warschau

Barocke Königliche Kapelle

Barocker Wilanów-Palast

Barocker Rogalin-Palast

Barocker Branicki-Palast in Białystok

Rokokoflügel des Königsschlosses

Rokoko Krakauer Piaristenkirche

Klassizistische Alte Bibliothek

Klassizistisches Belvedere

Klassizistischer Łazienki-Palast

Neogotisches Schloss Kamenz

Neoromanisches Nationalmuseum

Eklektizistische Galerie Zachęta

Neobarockes Adalbert-Sanatorium

Sezession Krakauer Kunstpalast

Modernes Präsidentenschloss

Rekonstruierte Warschauer Altstadt

Sozrealistisches Musikinstitut

Rekonstruierter Jabłonowski-Palast

Postmodernes Museum Polin
Vorromanik
Bis ins 9. Jahrhundert wurden die meisten Gebäude auf dem heute zu Polen gehörenden Gebiet aus Holz errichtet, wie zum Beispiel die Siedlung Biskupin. Aus dieser Zeit sind nur Grabhügel und kultische Steinzirkel erhalten, wie die Krakauer Hügelgräber Krak-Hügel und Wanda-Hügel. Die christliche Architektur kam im 9. Jahrhundert nach Kleinpolen, das unter den Einfluss des Großmährischen Reiches geriet. Die lateinisch-christliche Architektur kam als Vorromanik um die Mitte des 10. Jahrhunderts nach Großpolen. In diesem Stil wurden die Burgen und Kirchen der Polanen gebaut. In der polnischen Architekturgeschichte wird die Epoche der Vorromanik mit den Regierungszeiten der drei ersten historisch nachweisbaren Piasten Mieszko I., Bolesław I. und Mieszko II. angesetzt. Das älteste Steingebäude der Vorromanik in Polen dürfte der Posener Palas auf der Dominsel gewesen sein, der auf die 940er Jahre zurückgeht. Etwas jünger waren der Gieczer Palas und der Ostrów Lednickier Palas, die sich ebenfalls in Großpolen befanden, sowie der Przemyśler Palas. Die ersten Steinkirchen befanden sich ebenfalls vor allem in Großpolen, unter anderem der 968 begonnene Posener Dom, die vor 977 begonnene Gnesener Erzkathedrale und die 997 gegründete Benediktinerabtei in Tum, sowie auf dem Krakauer Wawel die Kirche B und die Rotunde der Allerheiligsten Jungfrau Maria, die jeweils aus der Zeit vor 970 stammen. Als im Jahr 1000 die Kirchenorganisation in Polen reformiert wurde, kamen mit dem Erzbistum Gnesen die Bistümer Krakau, Breslau und Kolberg zum ursprünglichen Bistum Posen hinzu. In allen Bistümern wurden um die vorletzte Jahrtausendwende Kathedralen errichtet, unter anderem auf dem Wawel in Krakau, der Dom auf der Breslauer Dominsel und der Kolberger Dom. 1038 erfolgte zu Beginn der Regierungszeit Kasimirs I., des Erneuerers, ein heidnischer Aufstand gegen die katholische Kirche in Polen, bei dem die meisten vorromanischen Gebäude zerstört wurden, so dass aus dieser Epoche bis auf die Rotunde auf dem Wawel nur Fundamente erhalten sind.
Romanik
Nach der Niederschlagung des heidnischen Aufstandes verlegte Kasimir I. der Erneuerer seinen Regierungssitz von Gnesen auf den Krakauer Wawel und begann, Polen im Stil der Romanik wieder aufzubauen. So wurden die Kathedralen in Gnesen, Krakau, Breslau, Kolberg und Posen im neuen Architekturstil wiedererrichtet sowie zahlreiche Rotunden (z. B. die Strehlener Gothardrotunde, die Teschener Nikolausrotunda oder die Strzelnoer Prokoprotunde), Wehrkirchen und Zisterzienser- sowie Benediktiner-Klöster gebaut. Die meisten romanischen Gebäude entstandne in der neuen Hauptstadt Krakau, wo noch die St.-Leonhards-Krypta in der Wawel-Kathedrale, die Albertkirche, die Andreaskirche, die Salvatorkirche, die die Zisterzienser-Abtei Kloster Mogila sowie die Benediktiner-Abtei Kloster Tyniec erhalten sind. Ebenfalls in Kleinpolen gehen die Kościelecer Albertkirche, die Sandomirer Jakobskirche, die Wiślicaer Marienbasilika, das Końskier Kollegiatstift, Opatówer Kollegiatstift, die Skalbmierzer Jakobskirche, die Benediktiner-Abtei Kloster Heiligkreuz, die Zisterzienser-Abtei Kloster Wąchock und die Zisterzienser-Abtei Kloster Jędrzejów auf die Romanik zurück. Großpolnische Bauwerke der Romanik sind die Benediktiner-Abtei Lubińer Kloster, die Inowłódzer Ägidiuskirche, das Kollegiatstift von Tum und das Kloster Sulejów mit der Thomaskirche. In Kujawien befindet sich neben der Strzelnoer Prokoprotunde auch die Dreifaltigkeitskirche im selben Ort, das Mogilnoer Benediktiner-Kloster sowie die Inowrocławer Marienkirche. In Schlesien gehen das Liegnitzer Piastenschloss, die Ägidiuskirche, die Breslauer Magdalenenkirche, das Prämonstratenserstift St. Vinzenz, die Beslauer Martinskirche, die St.-Bartholomäus-Krypta des Klosters Trebnitz, die Löwenberger Marienkirche, die Goldberger Marienkirche und die Gleiwitzer Bartholomäuskirche auf die Romanik zurück. In Pommern entstanden der Camminer Dom und die Zisterzienser-Abtei Kloster Kolbatz in der Zeit der Romanik. Aus der Romanik stammen in Masowien die Czerwińsker Regularkanonikerabtei und Płocker Kathedrale. Viele Gebäude der Romanik wurden während des Mongolensturms 1241 zerstört. Dieses Datum markiert auch das endgültige Ende der Epoche der Romanik in Polen. Der Wiederaufbau erfolgte bereits im Stil der Frühgotik.
Gotik
Die Gotik kam im 13. Jahrhundert auf der einen Seite aus Böhmen, unter anderem errichteten die Prager Parler das Krakauer Rathaus, zunächst nach Schlesien und von dort nach Groß- und Kleinpolen sowie später nach Masowien. Auf der anderen Seite brachte die Hanse und der Deutsche Orden die Backsteingotik nach Pommern, das Kulmer Land, Ermland und Masuren. So dominiert in Nordpolen die Backsteingotik und eine gemischte Backstein-Kalksteingotik im Süden, insbesondere in Krakau. Die Frühgotik fällt mir dem Wiederaufbau Polens nach dem Mongolensturm Mitte des 13. Jahrhunderts zusammen.
Die romanischen Kathedralen in Krakau, Breslau, Gnesen, Posen, Cammin, Płock und Oliva bei Danzig wurden in diesem Zusammenhang gotisiert und neue Kathedralen, wie die Kathedrale Mariä Himmelfahrt und St. Andreas in Frombork, die Nikolauskathedrale in Elbing, die Marienkathedrale in Pelplin, die Jakobskathedrale in Thorn, die Jakobskathedrale in Stettin, die Marienkathedrale in Köslin, die Marienkathedrale in Landsberg, die Kathedrale zum Heiligen Kreuz in Oppeln, die Kathedrale St. Peter und Paul in Liegnitz, die Stanislauskathedrale in Schweidnitz, die Marienkathedrale in Sandomir, die Marienkathedrale in Tarnów, die Marienkathedrale in Przemyśl, Marienkathedrale in Włocławek oder die Johanneskathedrale in Warschau, sowie Konkathedralen, wie die Dreifaltigkeitskonkathedrale in Kulmsee, die Dreifaltigkeitskonkathedrale in Kulmsee, die Marienkonkathedrale in Kolberg, die Johanneskonkathedrale in Marienwerder, die Jakobkonkathedrale in Allenstein, die Altbertkonkathedrale in Riesenburg und Hedwigkonkathedrale in Grünberg wurden in diesem Stil neuerrichtet.
Die Franziskaner und Dominikaner errichteten ab der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts ihre gotischen Klöster mit Klosterkirchen in den Innenstädten, wie die Krakauer Dreifaltigkeitskirche, die Krakauer Franziskuskirche, die Breslauer Albertkirche, die Breslauer Vinzenzkirche, die Danziger Dreifaltigkeitskirche, die Thorner Marienkirche, die Oppelner Dreifaltigkeitskirche, die Warschauer Annakirche und die Sandomirer Jakobskirche. Auch die Zisterzienser bauten im Stil der Gotik um, unter anderem in den Klöstern Mogila, Trebnitz, Kolbatz und Pelplin. Der Maltesterorden errichtete in Striegau die Peter und Paulbasilika. Der baute Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem erbaute die Johanneskirche in Gnesen und die Grabkirche in Miechów. Der Augustinerorden errichtete sein Kloster mit Katherinenkirche in Kazimierz bei Krakau.
Das in den im Zeitalter der Gotik stetig anwachsenden Bürgertum baute seine Pfarr- und Kollegiatskirchen im gotischen Stil um beziehungsweise baute neue gotische Pfarrkirchen, zum Beispiel in Krakau die Marienkirche, die Barbarakirche, die Markuskirche, die Heiligkreuzkirche, die Allerheiligenkirche (nicht erhalten) und die Kazimierzer Fronleichnamkirche, in Breslau die Elisabethkirche, Kreuzkirche, die St. Maria auf dem Sande, die Christophorikirche, die Katharinenkirche, die Fronleichnamkirche, die Dorotheakirche, die Matthiaskirche, die Magdalenenkirche, in Danzig die Marienkirche, die größte Backsteinkirche weltweit, die Nikolauskirche, Peter- und Paulkirche und die Katharinenkirche und in Thorn die Jakobskirche, die Neißer Jakobskirche, die Stettiner Johanneskirche, die Brieger Nikolauskirche, die Rügenwalder Marienkirche, die Stargarder Marienkirche, die Basilika zum heiligsten Erlöser und allen Heiligen in Guttstad, die Gleiwitzer Allerheiligenkirche, die Georgkirche in Rastenburg und die Herz-Jesu-Kirche in Sorau.
Gotische Holzkirchen sind unter anderem in Haczów, Dębno und Lipnica Dolna erhalten.
Das Bürgertum baute seine Rathäuser im neuen Stil. Die Parler errichteten das Rathaus in Krakau. Nennenswert sind zudem das Breslauer Rathaus, das Rechtstädtisches Rathaus in Danzig, das Thorner Rathaus, das Marienburger Rathaus, das Stargarder Rathaus, das Königsberger Rathaus und das Liegnitzer Rathaus. Unter anderem in Krakau (unter anderem das Długosz-Haus), Danzig (unter anderem das Schlieffhaus), Thorn (unter anderem den Junkerhof und das Kopernikus-Haus), Sandomierz (unter anderem das Długosz-Haus) und Stardard sind zahlreiche gotische Bürgerhäuser erhalten. Gotische städtische Wehranlagen und Stadtmauern sind unter anderem in Krakau, insbesondere der Abschnitt um das Florianstor mit dem Barbakan, in Danzig, insbesondere das Brotbänkentor, das Frauentor, das Häckertor, das Johannistor, das Milchkannentor, das Kuhtor, das Peinkammertor und das Krantor, in Stargard, unter anderem das Mühlentor, in Allenstein, insbesondere das Hohe Tor, in Szydłów, insbesondere das Krakauer Tor, in Sandomir, insbesondere das Opatower Tor, in Lublin, insbesondere das Krakauer Tor, in Neiße, insbesondere der Münsterberger Turm, in Patschkau und in Königsberg erhalten. Das Collegium Maius der Krakauer Universität geht ebenfalls auf die Gotik zurück. Die Glatzer Johannesbrücke wurde als kleinere Version der Prager Karlsbrücke gebaut. Die Juden bauten ihre ersten Synagogen ebenfalls im Stil der Gotik, unter anderem die Alte Synagoge in Kazimierz bei Krakau.
Die Königsburg auf dem Wawel, sowie zahlreiche Königsburgen der Piasten und des Adels wurden im Krakau-Tschenstochauer Jura (Adlerhorst-Burgen: die Königsburg Będzin, die Burg Bobolice, die Burg Korzkiew, die Burg Ojców, die Burg Tenczyn, die Burg Lipowiec, die Burg Rabsztyn, die Burg Smoleń, die Burg Mirów, die Burg Olsztyn, die Burg Siewierz, die Burg Przewodziszowice, die Burg Morsko, die Burg Danków sowie die Burg Ostrężnik), den Pieninen (Burg Niedzica, Burg Czorsztyn und Pieninen-Burg) und Beskiden (Dunajec-Burgen: die Burg Czchów, die Burg Tropsztyn, die Burg Rytro, die Burg Muszyna, die Burg Lanckorona, die Burg Zator, die Burg Auschwitz und die Salzgrafenburg Wieliczka sowie die Burg Dobczyce), dem Heiligkreuzgebirge (unter anderem die Burg Chęciny, die Burg Szydłów und die Burg Międzygórz), den Sudeten (unter anderem die Kynastburg, die Burg Fürstenstein, die Burg Tzschocha, die Burg Grodno, die Burg Grodziec, die Burg Ottmachau oder die Burg Frankenstein) sowie im Flachland (unter anderem die Burg Czersk, die Burg Toszek, die Burg Ciechanów, die Burg Łowicz, die Burg Wenecja, die Burg Thorn, die Burg Lublin oder die Burg Dębno) errichtet.
Der Deutsche Orden baute Ordensburgen im Stil der Backsteingotik im Kulmer Land, Ermland und Masuren. Zu den bekanntesten Ordensburgen im heutigen Polen gehören der Ordentssitz in Marienburg am Nogat- der größte gotische Backsteinbau der Welt, Marienwerder, Heilsberg, Mewe, Neidenburg, Barten, Thorn, Neidenburg, Osterode, Gollub, Rehden, Rößel, Schönberg, Hohenstein, Rastenburg, Allenstein, Braunsberg, Soldau, Schlochau, Lötzen und Bütow.
Kasimir III. der Große gliederte um 1340 Rotruthenien in die polnische Krone ein und Ladislaus II. Jagiełło christianisierte nach der im Jahr 1385 geschlossenen Union von Krewo Litauen von Polen aus. Dadurch kam der gotische Baustil der Westkirche in Gebiete, die heute zu Litauen, Weißrussland und der Ukraine gehören. Zu den wichtigsten gotischen Gebäuden im damaligen Osten von Polen-Litauen gehören die Lemberger Kathedrale, die Lemberger Kathedrale der polnischen Armenier (Mischung aus westlicher Gotik und armenischer Architektur), die Wilnaer Annakirche, die Wilnaer Franziskuskirche, der Wilnaer Gediminas-Turm, die Burg Trakai, die Burg Kaunas, die Burg Grodno, die Burg Lida, die Burg Mir und die Burg Luzk.
Renaissance
Das goldene Zeitalter Polens begann in der Spätgotik und reichte über die Renaissance und den Manierismus bis in den Frühbarock. Aus dieser Zeit (1350–1650) stammen die bedeutendsten Bauwerke Polens, allen voran das königliche Wawelschloss in Krakau. Kronprinz Sigismund I. weilte ab 1498 bei seinem Bruder Ladislaus II. von Böhmen und Ungarn am ungarischen Königshof, wo er mehrere florentinische Künstler und Architekten unter der Leitung von Francesco Fiorentino kennenlernte und nach Krakau holte, um das 1499 abgebrannte Königsschloss auf dem Wawel im Stil der italienischen Renaissance wieder aufzubauen. Francesco Fiorentino begann den Arkadenhof des Wawel-Schlosses zu bauen. Neben Francesco Fiorentino beteiligten sich auch Benedikt aus Sandomir und nach Francesco Fiorentinos Tod auch Bartolommeo Berrecci, Giovanni Battista Veneziani und Giovanni Cini aus Siena am Wiederaufbau. Bartolommeo Berrecci und Bernardino Zanobi de Gianotis bauten zudem an der Wawel-Kathedrale die Sigismundkapelle an, die als bedeutendstes Bauwerk der florentinischen Hochrenaissance außerhalb Italiens gilt. Weitere bedeutende Renaissance-Architekten aus Italien und dem Tessin, die in Polen-Litauen tätig waren, sind Bernardo Monti, Giovanni Quadro, Giovanni Maria Padovano und Mateo Gucci, welche die italienische Renaissance den klimatischen Bedingungen Mitteleuropas anpassten und so einen eigenen polnischen Renaissancestil schufen, der jedoch mit seinen beliebten Arkaden der florentinischen Renaissance am nächsten kam. Das Zentrum der Renaissance war Südpolen, insbesondere die Region Kleinpolen um Krakau und die Gegenden um Lemberg. Vor allem in Krakau kann man die typisch polnische Renaissancearchitektur an der Polnischen Attika erkennen.
Das Wawel-Königsschloss mit seinem Renaissance-Arkadenhof und die Sigismundkapelle wurden zum Vorbild für zahlreiche neue Bauwerke im ganzen Jagiellonenreich und wurde vom Königshof und den Adeligen in ganz Polen-Litauen sowie Schlesien hundertfach nachgebaut. Zu den bedeutendsten Renaissance-Schlössern zählen das Großfürstliches Schloss Vilnius, das Königsschloss Warschau, das Hohe Königsschloss Lemberg, das Königsschloss Piotrków Trybunalski, das Königsschloss Niepołomice, das Königsschloss Łobzów, das Königsschloss Łęczyca, das Königsschloss Radom, das Königsschloss Sanok, das Königsschloss Inowłódz, das Königsschloss Kalisz, das Königsschloss Posen, das Königsschloss Villa Regia, das Königsschloss Krzemieniec, das Königsschloss Podhorce, das Königsschloss Żółkiew, das Schloss Baranów Sandomierski, das Schloss Krasiczyn, das Schloss Przemyśl, das Schloss Nowy Sącz, das Schloss Pińczów, das Schloss Łańcut, das Schloss Uniejów, das Schloss Janowiec, das Schloss Krzyżtopór, das Schloss Tarnobrzeg, das Schloss Tarnów, das Schloss Sandomir, das Schloss Szydłowiec das Schloss Bodzentyn, das Schloss Bydlin, das Schloss Pieskowa Skała, das Schloss Iłża, das Schloss Sucha Beskidzka, das Schloss Siewierz, das Piastenschloss Brieg, das Schloss Nowy Wiśnicz, das Schloss Ogrodzieniec, das Schloss Książ Wielki, das Schloss Żywiec, das Schloss Szymbark, Schloss Melsztyn, Schloss Kazimierz Dolny, das Schloss Pilica, das Schloss Drzewica, das Schloss Tykocin, das Schloss Majkowice, das Schloss Ujazdów, der Bischofspalast Kielce, das Lemberger Königshaus, das Schloss Konstantynów, das Schloss Międzyrzecz Ostrogski, das Schloss Nieśwież, das Schloss Mir sowie die Festung Kamieniec Podolski. Viele dieser Bauwerke haben die Zeit der schwedischen Kriege im 17. Jahrhundert nur als Ruinen überdauert.
Anders als in der Gotik entstanden in der Renaissance nur wenige Kirchen im Renaissance-Stil, dem sich mehr die weltliche Architektur widmete. Bedeutendster sakraler Bau der Hochrenaissance war die Kathedrale von Płock, die um 1530 von Bernardino Zanobi de Gianotis, Giovanni Cini und Filippo Fiesole im Renaissance-Stil umgebaut wurde. Weitere erhaltene Renaissance-Kirchen in Polen-Litauen sind die Pułtusker Marienbasilika, die Lemberger Mariä-Entschlafens-Kirche, Lemberger Allerheiligenkirche, Lemberger Andreaskirche die Brochówer Wehrkirche und die Broker Andreaskirche sowie die Lemberger Goldene-Rosen-Synagoge. Es wurden jedoch zahlreiche Renaissance-Kapellen nach dem Vorbild der Sigismundkapelle an gotischen Kirchen errichtet, unter anderem für die weiteren Kapellen der Wawel-Kathedrale, unter anderem die Vasa-Kapelle, die Załuski-Kapelle die Tomicki-Kapelle, die Johann-I.-Kapelle, die Myszkowski-Kapelle, die Potocki-Kapelle und die Zadzika-Kapelle, die Maciejowski-Kapelle und die Hyazinth-Kapelle der Krakauer Dominikanerkirche, die Lubomirski-Kapelle in Niepołomice, die Annakapelle in Pińczów, die Krasiczyn-Kapelle auf dem Schloss Krasiczyn, die Antonius-Kapelle der Przeworskier Bernhardinerkirche, die Kasimir-Kapelle der Wilnaer Stanislauskathedrale sowie die Boim-Kapelle und die Kampianów-Kapelle in der Lemberg Marienkathedrale.
Gleichzeitig entwickelte sich am Übergang zwischen Spätgotik und Renaissance auch die bürgerliche Architektur in den Städten in Polen-Litauen, die viele Rathäuser, Bürgerhäuser des Patriziats sowie Gebäude anderer öffentlichen Einrichtungen, wie zum Beispiel die Krakauer Tuchhallen, das Collegium Iuridicum und das Collegium Nowodworski der Krakauer Akademie, das Kazimierzer Rathaus, das Posener Rathaus, das Tarnówer Rathaus, das Sandomirer Rathaus, in Krakau die Villa Decius, der Erasmus-Ciołek-Bischofspalast, das Bischof-Florian-Haus, das Dziekański-Haus, das Górków-Haus, das Długosz-Haus, das Maciejowski-Haus und das Bonerhaus, in Posen der Górków-Palast, in Warschau der Barbakan, das Baryczkowska-Haus und das Falkiewiczowska-Haus, in Danzig das Ferberhaus und in Vilnius das Tor der Morgenröte, hervorbrachte, die entweder im Renaissancestil um- oder neugebaut wurden. Auch in dem in der Renaissance zu Böhmen gehörenden Schlesien wurden zahlreiche profane Bauten im Stil der Renaissance errichtet, unter anderem das Laubaner Rathaus, das Ottmachauer Rathaus, das Patschkauer Rathaus, das Wünschelburger Rathaus, das Löwenberger Rathaus sowie das Schloss Frankenstein und Schloss Plagwitz. In Pommern wurde von den Greifen das Stettiner Schloss in Renaissance-Stil erbaut.
In der Renaissance wurden in Polen-Litauen zahlreiche Schlossgärten angelegt, von denen die meisten nicht erhalten geblieben sind beziehungsweise später zu Barockgärten umgestaltet wurden. Den ersten Renaissance-Garten hat Königin Bona Sforza und König Sigusmund I. der Alte in den 1530er Jahren vor dem Ostflügel des Wawel-Schlosses angelegt. Die Königsgärten auf dem Wawel wurden später im Barockstil umgebaut, sind jedoch nicht in den folgenden Jahrhunderten verwahrlost. Endgültig zerstört wurden sie im Zweiten Weltkrieg, als der auf dem Wawel residierende Generalgouverneur Hans Frank an ihrer Stelle ein Schwimmbad und Tennisplätze bauen ließ. Ab den 1990er Jahren wurden die Königsgärten wieder rekonstruiert und sind seit 2005 für die Öffentlichkeit wieder zugänglich. Weitgehend original erhalten sind dagegen die Renaissance-Gärten des Schlosses Pieskowa Skała. Die Renaissance-Gärten des Schloss Fürstenstein sind hingegen ebenfalls eine Rekonstruktion aus dem 21. Jahrhundert.
Manierismus
Die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts lässt sich in der Architekturgeschichte Polen-Litauens in vier regionale Zentren mit verschiedenen Stilrichtungen einteilen. Krakau und seine Umgebung weitgehend der italienischen Hochrenaissance blieben der florentinischen Hochrenaissance treu und adaptierten den italienischen Manierismus in die neuen Bauten. Bedeutendster Vertreter des Südpolnischen Manierismus in der Architektur war der gebürtige Florentiner Santi Gucci. Daneben sind als südpolnische Manierismusarchitekten die Polen Gabriel Słoński, Szymon Sarocki, Michał Hintz, Tomasz Nikiel und Jan Michałowicz, die Italiener Paolo Romano, Antonio Pellaccini, Niccolò Castiglione, Galeazzo Appiani, Antoneo de Ralia, Giovanni Maria Bernardoni und Pietro di Barbone sowie die Niederländer Hiob Praÿetfuess und Paul Baudarth zu nennen. Nordpolen und insbesondere Danzig begann sich am niederländisch-flämischen Stil des Manierismus zu orientierten und holte seine Architekten vor allem aus den Niederlanden. Zu diesen gehörten Hans Vredeman de Vries, Anton van Obberghen, Hans Kramer, Willem van den Blocke, Abraham van den Blocke und Hans Strackwitz. Die Gegend um Lublin entwickelte einen eigenen Stil aus der Mischung von italienischen und niederländischen Stilelementen zur Lubliner Renaissance, die bis weit in den polnisch-litauischen Osten ausstrahlte. Hier waren vor allen italienische und polnische Architekten wie Bernardo Morando, Andrea dell’Aqua, Jan Jaroszewicz und Jan Wolff tätig. König Sigismung III. Vasa war dagegen ein Befürworter der Gegenreformation und der Jesuiten und holte in den letzten beiden Dekaden des 16. Jahrhunderts den Frühbarock nach Polen-Litauen, zunächst nach Krakau und Litauen und später vor allem in den neuen Sitz des Königshofs nach Warschau. Für ihn waren vor allem Architekten aus dem Tessin tätig.
Viele Renaissance-Schlösser in Südpolen, wie das Schloss Baranów Sandomierski, das Schloss Krasiczyn, das Schloss Pinczów, das Saybuscher Schloss oder der Bischofspalast Kielce, die erst in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts fertig gestellt wurden, erhielten einen manieristischen Strich, für den oft Santi Gucci verantwortlich zeichnete. Auf dem Wawel gehen das Vasa-Tor und das Berecci-Tor auf den Manierismus zurück. Beispiele für bürgerliche Architektur des Manierismus in Südpolen sind das Beitscher Rathaus, Patrizierhäuser an Marktplatz in Tarnów, das Jarosławer Orsetti-Haus sowie in Krakau das Branicki-Haus, das Dekan-Haus und das Prälat-Haus sowie das Collegium Gostomianum in Sandomierz. Zur sakralen maniertischen Architektur in Südpolen zählen die Krakauer Synagogen Remuh-Synagoge, die Popper-Synagoge und die Hohe Synagoge sowie die Lesko Synagoge, Tykociner Große Synagoge und das Kloster Kalwaria-Zebrzydowska mit der Marienbasilika und den Kapellen des Kalvarienbergs, von denen die Ecco-Homo-Kapelle, die Kreuzigungskapelle sowie die Herz-Marien-Kapelle klare manieristische Züge haben, die Kielcer Marienkathedrale, das Kloster Leżajsk, die Przemyśler Karmelitenkirche, die Rzeszówer Bernhardinerkirche, die Bejscer Nikolauskirche, die Jarosławer Fronleichnamkirche, die Jarosławer Nikolauskirche, die Pińczówer Johanneskirche, die Pińczówer Annakapelle, die Pińczówer Alte Synagoge, die Rytwianyer Kamaldulenserkirche, die Saybuscher Marienkathedrale sowie die Staszówer Tęczyński-Kapelle.
Zentrum des Manierismus in Nordpolen war Danzig, wo im manierischen Stil das das Altstädtische Rathaus, das Rechtstädtische Rathaus, Große Zeughaus, der Artushof, das Hohe Tor, das Grüne Tor, das Goldene Tor, das Goldene Haus, das Englische Haus, das Ferberhaus, das Löwenschloss, das Schumannhaus, das Köpehaus, das Drei-Prediger-Haus, das Schlüterhaus neu errichtet oder umgebaut wurden. Auch das Kulmer Rathaus, die Bromberger Klarissenkirche, die Marienkapelle an der Włocławeker Marienkathedrale, Getreidespeicher und Bürgerhäuser am Neustädter Marktplatz in Thorn wurde im manieristischen Stil umgebaut. In Pommern sind neben dem Stettiner Schloss auch das Schloss Stolpe, Schloss Krangen, Schloss Pansin und Schloss Tütz erhalten, die ebenfalls im Manierismus umgebaut wurden.
Als Vereinigung von italienischen und niederländischen Stilelementen entstand der Architekturstil der Lubliner Renaissance in der Gegend um Lublin. In diesem Stil wurden ganze Idealstädte, wie Zamość von Jan Zamoyski oder Żółkiew von Stanisław Żółkiewski, neu erbaut beziehungsweise vollkommen umgebaut, wie Kazimierz Dolny. Zu den wichtigsten erhaltenen Baudenkmälern der Lubliner Renaissance zählen in Lublin die Josephskirche, die Dominikanerkirche mit der Ossoliński-Kapelle, das Konopnica-Haus und das Chociszewski-Haus, sowie in Zamość das Rathaus, die Thomaskathedrale, die Synagoge, die Armenier-Häuser, das Madonna-Haus, das Ehepaar-Haus, das Lublin-Haus, das Morando-Haus, das Dymitr-Grek-Haus, die Festungsanlagen mit dem Lublin-Tor und dem Lemberger-Tor, in Kazimierz Dolny die Johanneskirche, das Celej-Haus, die Przybyła-Häuser, der Przybyła-Speicher und das Schloss Janowiec. Weitere Beispiele für Baudenkmäler der Lubliner Renaissance sind das Orzechowski Schloss, die Janowiecer Margaretenkirche, die Gołąber Marienkirche und das Gołąber Loreto-Haus. Weitere manieristische Gebäude in Zentralpolen, die nicht unmittelbar zur Lubliner Renaissance gezählte werden, die Landsberger Hedwigskirche, die Krasner Heiligkreuzkirche, das Szydłowiecer Rathaus, das Ridt-Haus in Posen, das Schloss Szydłowiec, das Schloss Carolath, das Schloss Schönaich, das Schloss Pabianice sowie das Schloss Grudziński in Poddębice.
Auch in die aufstrebende Hauptstadt Masowiens Warschau zog der Manierismus ein, wo die Jesuitenkirche, das Mohren-Haus, das Baryczka-Haus, das Chociszewski-Haus, das Salvator-Haus, Heilige-Anna-Haus und die Häuser am Kanonia Platz, entstanden.
Auch das böhmische Schlesien war reich an manierischen Schlössern, Kirchen und bürgerlicher Architektur. Da Schlesien jedoch als Teil Böhmens im Dreißigjährigen Krieg stark im Mitleidenschaft gezogen wurde, sind nur relativ wenige Baudenkmäler aus der Zeit des Manierismus erhalten. Zu diesen gehören das Schloss Krieblowitz, das Schloss Oels, das Piastenschloss Ohlau, die manieristisch ausgebaute Burg Grodno, die Rothsürbener Dreifaltigkeitskirche sowie das Breslauer Haus unter den Greifen in Niederschlesien und das Schloss Falkenberg das Piastenschloss Brieg, das Brieger Rathaus sowie das Neißer Kämmereigebäude in Oberschlesien.
Barock
Der polnisch-litauische Barock lässt sich in drei Phasen einteilen, den Frühbarock unter der Vasa-Dynastie in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, den reifen Barock unter Michael I. und Johann III. Sobieski in der zweiten Jahrhundertshäfte sowie den Spätbarock, der unter den Wettinern in der ersten Jahrhunderthälfte des 18. Jahrhunderts in den Rokoko überging, in Litauen dagegen in dem Wilnaer Barock mündete. Bedeutende Architekten, die während des Barocks in Polen-Litauen tätig waren, kamen ebenfalls zum großen Teil aus Italien beziehungsweise dem schweizerischen Tessin. Zu ihnen gehörebn Andrea dell'Aqua, Giovanni Bay, Carlo Antonio Bay, Kacper Bażanka, Piotr Beber, Simone Giuseppe Bellotti, Giovanni Maria Bernardoni, Cristoforo Bonadura der Jüngere, Cristoforo Bonadura der Ältere, Giuseppe Brizio, Andrea Castelli, Antonio Castelli, Matteo Castelli, Andrea Catenazzi, Giovanni Catenazzi, Georgio Catenazzi, Giovanni Battista Gisleni, Pompeo Ferrari, Albin Fontana, Giacomo Fontana, Giovanni Fontana, Paolo Antonio Fontana, Karol Marcin Frantz, Johann Georg Knoll, Johann Christoph Glaubitz, Wojciech Kielar, Jan Koński, Johann Christoph Knöffel, Augustyn Wincenty Locci, Krzysztof Mieroszewski, Pietro Peretti, Francesco Placidi, Tommaso Poncino, Matthäus Daniel Pöppelmann, Ephraim Schröger, Laurentius de Sent, Francesco Solari, Constantino Tencalla, Giovanni Trevano, Bartłomiej Nataniel Wąsowski und Jan Zaor. Der bedeutendste polnische Barockarchitekt, Tylman van Gameren, stammte jedoch aus den Niederlanden, der Hunderte von Schlössern in ganz Polen projektierte.
Der Frühbarock entwickelte sich in Polen noch während der Manierismus vorherrschend war, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Sigismund III. Vasa holte die Tessiner Architekten Giovanni Trevano, Matteo Castelli und Tommaso Poncino an den polnisch-litauischen Königshof, der Ende des 16. Jahrhunderts von Krakau nach Warschau gezogen war. So wurde auch Warschau neben Krakau das Zentrum des polnisch-litauischen Frühbarocks, während in Norden und Osten der Adelsrepublik weiterhin der Manierismus dominierte. Die ersten sakralen Bauten, die im Stil des Frühbarock entstanden waren oft mit den Jesuiten und der Gegenreformation verbunden. Zu ihnen zählen die Vasa-Kapelle an der Wawel-Kathedrale und die Kasimir-Kapelle an der Wilnaer Stanislauskathedrale, die Wilnaer Theresienkirche, die Nieświeżer Jesuitenkirche, die Krakauer Jesuitenkirche, das Wieliczkaer Franziskanerkirche, die Krakauer Kamaldulenserkirche, die Krakauer Martinskirche, die Warschauer Dominikanerkirche, die Klimontówer Josephskirche, die Lemberger Jesuitenkirche, die Ołykaer Dreifaltigkeitskirche und das Kloster Heiligelinde. Zu prophanen Baudenkmälern des Frühbarock zählen der Ende des 16. Jahrhunderts nach einem Brand wiederaufgebaute Nordflügel des Wawel-Schlosses (Saal unter den Vögeln und Senatorentreppe), das Warschauer Königsschloss, der Warschauer Kazanowski-Palast sowie das Schloss Ujazdów. Zu der frühbarocken bürgerlichen Architektur gehört das Lissaer Rathaus.
In der Zeit des reifen Barocks trat die neue Hauptstadt Warschau als Mittelpunkt hervor, wo vor alle Tylman van Gameren tätig war. Bedeutende Sakralbauten des Hochbarocks sind die Warschauer Kasimirkirche, Krakauer Annakirche, Krakauer Thomaskirche, die Krakauer Kapuzinerkirche, die Krakauer Maria-Empfängnis-Kirche, die Krakauer Agneskirche, die Krakauer Visitantinnenkirche, Krakauer Theresienkirche, die Krakauer Prämonstratenserinnenkirche die Rzeszówer Heiligkreuzkirche, die Gostyńer Heiligbergkirche, die Węgrówer Marienbasilika, die Lissaer Nikolausbasilika, die Wilnaer Peter-und-Paulskirche, die Posener Jesuitenkirche, die Grodner Jesuitenkirche, Przemęter Johanneskirche, das Posener Jesuitenkolleg, die Posener Josephskirche, das Kloster Woźniki, das Kloster Tschenstochau, die Danziger Königliche Kapelle, die Lubliner Johanneskathedrale, die Kalischer Albrechtkirche, die Pińsker Jesuitenkirche, die Koronowoer Marienbasilika, die Thorner Dreifaltigkeitskirche, die Graudenzer Jesuitenkirche, die Jarosławer Marienkirche, die Łowiczer Marienkirche, die Warschauer Kapuzinerkirche, die Czerniakówer Antoniuskirche und die Warschauer Antoniuskirche. Große Paläste im Versailler Stil entstanden in und um Warschau, wie zum Beispiel der Wilanów-Palast, der Koniecpolski-Palast, der Czapski-Palast, der Pac-Palast, das Palais Marymont, der Ossoliński-Palast, der Primas-Palast, der Krasiński-Palast, das Schloss Ostrogski, das Eiserne Tor oder das Handelszentrum Marywil, sowie in und um Masowien, wie zum Beispiel der Puławer Czartoryski-Palast, der Otwocker Palast, das Schloss Nieborów, sowie in Ostpolen, wie zum Be·ispiel der Białystoker Branicki-Palast, der Lubliner Lubomirski-Palast, das Schloss Łańcut, das Schloss Rzeszów oder das Schloss Ostrometzko. In Wejherowo stiftete Jakob von Weiher den Kaschubischen Kalvarienberg. In Danzig entstanden das Schildkrötenhaus, das Lachshaus, das Haus am Langen Markt 20 und das Czirenberg-Haus.
Der Spätbarock entwickelte sich parallel zum Rokoko. Während in Warschau bereits das Rokoko dominierte entwickelte sich im Osten Polen-Litauens die Wilnaer Schule des Barock, auch Wilnaer Barock genannt, deren Hauptvertreter Johann Christoph Glaubitz war. Zu den bedeutendsten Werken des Wilnaer Barock zählen in Wilna und Umgebung die Augustianerkirche, Augustianerkirche, Heilig-Geist-Kirche, Jesuitenkirche, die Budsławer Bernhardinerkirche, die Katherinenkirche, das Kloster Pažaislis, die Berezweczer Basilianerkirche und die Połocker Sophiakirche. Zu den spätbarocken sakralen Bauwerken zählt auch die Lemberger Dominikanerkirche, die Lemberger Sankt-Georgs-Kathedrale, die Krzemieniecer Jesuitenkirche, die Zbarażer Bernhardinerkirche, die Zasławer Bernhardinerkirche, die Drohiczyner Bernhardinerkirche, die Poczajówer Marienkirche, die Lubartówer Annakirche, die Berdyczówer Marienkirche, die Chełmer Marienbasilika, die Opole Lubelskier Marienkirche die Tarnopoler Dominikanerkirche, die Trzemesznoer Marienkirche, das Trinitarierkloster Beresteczko, das Zisterzienserkloster Wągrowiec, das Kloster Tarnobrzeg, das Kamaldulenserkloster Wigry, das Kloster Ląd, das Karmelitenkloster Zagórz, die Tykociner Dreifaltigkeitskirche, die Kobyłkaer Dreifaltigkeitsbasilika, die Sejner Marienbasilika, die Chełmer Marienbasilika, das Krakauer Paulinerkloster, die Krakauer Paulskirche und die Warschauer Heiligkreuzkirche. Zu den spätbarocken profanen Bauten in Polen-Litauen zählen in Warschau das Sächsisches Palais, der Sapieha-Palast, der Bischofspalast, der Palast unter dem Blechdach, das Palais Kotowski, der Blank-Palast, das Palais Sanguszko, das Małachowski-Palais, der Symonowicz-Palast und der Blaue Palast sowie in Ostpolen der Puławyer Czartoryski-Palast, der Radzyńer Potocki-Palast, Rogaliner Raczyński-Palast, der Zasławer Sanguszko-Palast, der Choroszczer Branicki-Palast, der Ciążeńer Bischofspalast, das Schloss Rydzyna, der Bischofspalast Wolbórz, der Lubartówer Sanguszko-Palast, der Kozłówker Zamoyski-Palast, der Wieliczkaer Konopków-Palast, der Rzeszówer Lubomirski-Palast und der Krystynopoler Potocki-Palast. Zur bürgerlichen Architektur des Spätbarock zählen das Białystoker Rathaus und das Mławer Rathaus. Im Spätbarock entstand auch die Holzkirche St. Michael in Szalowa.
Im damals böhmischen Schlesien entwickelte sich nach den Verwüstungen des Dreißigjährigen Kriegs eine rege Bautätigkeit in der Epoche des Barock. Erhalten geblieben beziehungsweise nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut sind unter anderem in Breslau das Stadtschloss, der Erzbischofpalast, die Namen-Jesu-Kirche, die Antoniuskirche, die Klarakirche, die Kyrill-und-Method-Kirche, die Hofkirche, die Dreifaltigkeitskirche, das Matthias-Gymnasium (Ossolineum) und das Kloster der Kreuzherren mit dem Roten Stern. Vom Palais Hatzfeld ist nur das Eingangsportal erhalten. Weitere bedeutende barocke Baudenkmäler sind über ganz Schlesien verteilt: die Mariä-Heimsuchung-Basilika in Bardo, die Marienbasilika in Grüssau, die Marienkirche in Leubus, das Kloster Paradies, das Kloster Kamenz, das Benediktinnenkloster Liegnitz, die Liegnitzer Johanneskirche, die Albendorfer Wallfahrtsbasilika, die Schädelkapelle Tscherbeney, die Seitscher Martinskirche, die Wohlau Karlskirche, die Brieger Kreuzerhöhungskirche, die Neißer Peter-und-Paulsirche, die Bielitzer Gottesvorsehungskirche, die Teschener Jesuskirche, die Ottmachauer Nikolauskirche, die Jauerer Friedenskirche, die Schweidnitzer Friedenskirche, das Sprottauer Rathaus, das Bunzlauer Rathaus, das Hirschberger Rathaus, das Liegnitzer Alte Rathaus, das Glatzer Jesuitenkolleg, das Wallensteinsche Schloss Sagan, das Schloss Mittelwalde, das Schloss Annaberg, das Schloss Lessendorf und das Schloss Buchenhöh. Eine besonders hohe Dichte an Herrensitzen, Schlössern und Palästen weist das Hirschberger Tal auf. Auch Schloss Fürstenstein wurde im Barock ausgebaut.
Während des Dreißigjährigen Krieges starb das pommersche Fürstengeschlecht der Greifen aus und Pommern gehörte während des Hoch- und Spätbarock zu Schweden. Im Gegensatz zu Schlesien sind in Pommern relativ wenige barocke Architekturdenkmäler erhalten geblieben beziehungsweise nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut worden. Zu diesen gehören das Landeshaus, das Königs- und das Berliner Tor in Stettin, das Rügenwalder Rathaus, die Stargarder Hauptwache und das Schloss Manteuffel.
In der Zeit des Barock wurden in Polen-Litauen auch zahlreiche Gärten und Parkanlagen angelegt, unter anderem der Warschauer Königsschlossgarten der Sächsische Garten, der Krasiński-Garten, Łazienki-Park, Ujazdowski-Park, der Lubomirski-Garten, der Raczyński-Garten und der Branicki-Garten.
Rokoko
Der Spätbarock und das Rokoko sind von der Zeit der Sachsenkönige geprägt, insbesondere der Regierungszeit des zweiten Sachsenkönigs August III. Beide Sachsenkönige brachten ihre in Dresden tätigen Architekten und Künstler an den Königshof in Warschau, wo der neue Stil schnell angenommen wurde. Als erster Architekt, der im Rokoko-Stil in Polen-Litauen baute, gilt der in Turin geborene Franzose Juste-Aurèle Meissonnier, der im Puławyer Czartoryski-Palast und später in Warschau tätig war. Der wichtigste Architekt des polnischen Rokoko war allerdings wie bereits seit der Renaissance ebenfalls ein Italiener – der gebürtige Römer Francesco Placidi . Zu weiteren bedeutendsten Rokoko-Architekten, die in Polen-Litauen tätig waren, zählen Jan de Witte, Joachim Daniel Jauch, Johann Friedrich Knöbel, Bernhard Meretyn, Giacomo Fontana, Ricaud de Tirregaille, Tomasz Rezler und Johann Sigmund Deybel von Hammerau. Die meisten Rokoko-Bauten entstanden in Warschau, sind jedoch aufgrund der Zerstörung des Zweiten Weltkriegs nicht erhalten geblieben und wurden aufgrund des großen Aufwands nur vereinzelt rekonstruiert. Über den Wiederaufbau der Westseite des ehemaligen Sachsen Platzes mit dem Sächsischen Palais, dem Brühlschen Palais und den Bürgerhäusern an der Ecke des Platzes zur Königsstraße wird seit 2005 diskutiert.
Zu den wichtigsten erhaltenen Gebäuden, die im Stil des polnisch-litauischen Rokoko neu- oder umgebaut wurden, gehören die sakralen Bauten, wie die Warschauer Visitantinnen-Kirche, die Warschauer Anna-Kirche, die Warschaue Heilig-Kreuz-Kirche, die Lemberger Dominikanerkirche, die Lemberger Georgskathedrale, die Wilnaer Johanneskirche, die Wilnaer Karmelitenkirche, die Włodawaer Paulinerkirche,die Berezweczer Basilianerkirche, die Horodenkaer Theatinerkirche, die Lemberger Kasimirkirche, das Mariä-Entschlafens-Kloster Potschajiw, die Chełmer Apostelkirche und die Krakauer Piaristenkirche. Die Holzkirche St. Stephan in Mnichów gilt als einzige erhaltene Holzkirche des Rokoko.
Zu den wichtigsten erhaltenen Gebäuden, die im Stil des polnisch-litauischen Rokoko neu- oder umgebaut wurden, gehören die profanen Bauten, wie der Äbtepalast zu Oliva, der Bischofspalast Ciążeń der Tscherwonohrader Potocki-Palast, das Butschatscher Rathaus, das Krakauer Markgrafenhaus, das Warschauer John-Haus, das Warschauer Palais Abramowicz, der Warschauer Borch-Palast, der Warschauer Branicki-Palast an der Honigstraße, das Warschauer Prażmowski-Palais, der Młociner Brühl-Palast, der Warschauer Chodkiewicz-Palast, der Warschauer Dembiński-Palast, das Warschauer Stroński-Palais, der Warschauer Przebendowski-Palast, der Warschauer Humański-Palast, der Warschauer Jabłonowski-Palast, der Warschauer Wessel-Palast, der Warschauer Szaniawski-Palast, das Warschauer Chodkiewicz-Palais an der Kirchgasse, der Warschauer Collegium Nobilium, der Warschauer Potocki-Palast, der Warschauer Palast zu den vier Winden, der Warschauer Mokronowski-Palast, das Warschauer Palais Sanguszko, der Warschauer Zamoyski-Palast an der Neuen Welt, der Warschauer Młodziejowski-Palast, der Warschauer Radziwiłłowa-Palast, der Warschauer Potkański-Palast, der Warschauer Karaś-Palast, das Warschauer Tepper-Palais und das Warschauer Palais Lelewel (die drei Letztgenannten nach dem Zweiten Weltkrieg noch nicht wieder aufgebaut), der Lemberger Lubomirski-Palast, der Kotuliński-Palast in Czechowice-Dziedzice und die Orangerie des Potocki-Palastes in Radzyń Podlaski.
In Schlesien sind aus der Zeit des habsburgerischen Rokoko vor allem Mariensäulen erhalten, wie zum Beispiel die Leobschützer Mariensäule, die Ratiborer Mariensäule, die Hirschberger Mariensäule (trägt bereits klassizistische Züge), die Glatzer Mariensäule und Oberglogauer Mariensäule (beide Übergang vom Barock zum Rokoko).
Klassizismus
In den Jahren der Regentschaft des letzten polnisch-litauischen Königs Stanislaus II. August Poniatowskis begann die Epoche des Klassizismus, der frühe Klassizismus wird in Polen-Litauen daher auch als Stanislaus-Stil bezeichnet. Nach der Dritten Teilung Polens und der Abdikation von Stanislaus II. August Poniatowski 1795 überdauerte der Klassizismus die napoleonische Zeit bis in die Zeit des Kongresspolens vor dem Novemberaufstand. Zentrum des Klassizismus war wieder Warschau und wieder waren es italienische Architekten, die die Architektur Polen-Litauens in dieser Kulturepoche prägten, allen voran Domenico Merlini und Carlo Spampani unter Stanislaus II. August Poniatowski sowie Antonio Carozzi in Kongresspolen des frühen 19. Jahrhunderts. Weitere bedeutende Architekten des Klassismus in Polen-Litauen waren Chrystian Piotr Aigner, Laurynas Gucevičius, Johann Christian Kamsetzer, Ephraim Schröger, Wilhelm Heinrich Minter, Stanisław Zawadzki, Jakub Kubicki und Simon Gottlieb Zug.
Das ehrgleizigste Bauprojekt Stanislaus II. August Poniatowskis war der Ausbau der Schlösser und Paläste im Warschauer Königlichen Park der Bäder „Łazienki Królewskie“. Hierzu ließ er durch Domenico Merlini und Johann Christian Kamsetzer das Badeschloss der Lubomirski in Ujazdów bei Warschau in den Palast auf dem Wasser umbauen. Auf Domenico Merlini gehen im Łazienki-Park zudem die Eremitage, das Weiße Haus, das Jagdschloss, der Wasserturm, die Neue Wache und die Alte Orangerie sowie auf Johann Christian Kamsetzer die Alte Wache und das Amphitheater. Die Offizierschule und Invalidenkasserne im Łazienki-Park geht auf Wilhelm Heinrich Minter zurück. Jakub Kubicki baute im Park das Belvedere, der Sybillen-Tempel, der Ägyptische Tempel, die Reitschule, der Kubicki-Stahl und das erste Projekt des Tempels der Göttlichen Vorsehung. Die Neue Orangerie wurde von Adolf Loewe und Józef Orłowski gestaltet und das Narutowicz-Haus auf Andrzej Gołoński. Weitere bekannte romantische Parkanlagen neben dem Łazienki-Park wurden im 18. Jahrhundert in Puławy, Arkadia und Radziejowice angelegt.
Weitere Beispiele des Stanislaus-Stils sind der Parlamentssaal auf dem Warschauer Königsschloss, der Jabłonnaer Potocki-Palast, der Warschauer Królikarnia-Palast, der Natoliner Potocki-Palast die Warschauer Orthodoxe Marienkirche, die Warschauer Karmelitenkirche die Warschauer Kadettenanstalt, das Warschauer Jacobson-Haus, der Warschauer Dziekana-Palast, die Grochów-Wache, die Mokotów-Wache, die Powązkier Karlskirche, der Warschauer Borch-Palast, der Warschauer Raczyński-Palast, der Warschauer Tyszkiewicz-Palast, die Dorotheakirche in Petrykozy, die Hofgebäude des Warschauer Czapski-Palast, die Warschauer Dreifaltigkeitskirche, das Warschauer Roesler und Hurtig Haus, die Jakobskirche in Skierniewice, die Marienkathedrale in Łowicz, der Skórzewski-Palast in Lubostroń, Ogiński-Palast in Siedlce, Potocki-Palast in Tulczyn, der Garten Arkadia, der Jabłonowski-Palast und die Marienkirche in Kock sowie das Burggassentor in Lublin.
Im Stil des späten Klassizismus wurde das damals größte Theatergebäude der Welt von Antonio Corazzi, der im Stil des Palladianismus schuf, in Warschau errichtet. Dazu kamen die Gebäude der Alten Warschauer Wertpapierbörse, der Polnischen Bank, der Leszczyński-Palast, das Ursynówer Krasiński-Palais, der Hołowczyc-Palast, der Staszic-Palast, der Lubomirski-Palast, der Uruski-Palast, der Mostowski-Palast, das Palais Śleszyński, das Palais zur Artischocke, das Warschauer Arsenal, das Haus unter den Säulen, das Warschauer Astronomische Observatorium sowie die Warschauer Alexanderkirche. Zu spätklassizistischen Baudenkmälern zählen die Warschauer Zitadelle, die Warschauer Alte Synagoge sowie die Warschauer Hospitalsynagoge (die beiden Letztgenannten im Zweiten Weltkrieg zerstört). Auf Antonio Corazzi geht auch der Radomer Sandomierski-Palast zurück.
Bedeutende klassizistische Baudenkmäler außerhalb von Warschau sind das Oppelner Alte Posthaus, die Breslauer Elftausend-Jungfrauen-Kirche sowie die Breslauer Alte Börse, die Reichenbacher Maria-Mutter-der-Kirche-Kirche, die Porembaer Fürstliche Fasanerie, die Płocker Kleine Synagoge, der Pawlowitzer Mielżyński-Palast, die Tschenstochauer Neue Synagoge, der Zegrzer Radziwiłł-Palast, das Schloss Dyhernfurth, das Schloss Juditten, die Groß Wartenberger Evangelische Kirche, die Krippitzer Synagoge, die Orlaer Synagoge, die Praschkauer Synagoge, die Siemiatyczer Synagoge, die Kempener Synagoge, die Włodawaer Große Synagoge, das Grottkauer Rathaus, das Dobberschützer Pantheon, das Płocker Rathaus, das Oelser Rathaus, der Ostrometzkoer Mostowski-Palast, die Puławyer Marienkirche, die Lodscher Heilig-Geist-Kirche, das Puławyer Marynki-Palais, der Puławyer Sybillen-Tempel, die Suwałkier Alexanderkonkathedrale, der Wilnaer Bischofspalast und das Rathaus Vilnius.
Historismus
Der Historismus begann im bereits zwischen Preußen, Russland und Österreich geteilten Polen-Litauen um die Jahrhundertwende des 18. zum 19. Jahrhundert, als der Klassizismus noch anhielt. Als erstes Bauwerk des Historismus gilt das neogotische Gotikhaus im romantischen Park Puławy des klassizistischen Architekten Chrystian Piotr Aigner aus der ersten Dekade des 19. Jahrhunderts. Die Zentren der polnischen Architektur des 19. Jahrhunderts waren in Kongresspolen Warschau und Łódź, wo viele Bürgerhäuser und Schlösser im Stil des Historismus errichtet wurden, in Gazizien Krakau und Lemberg sowie Posen und Bydgoszcz in Preußen.
Als erster Stil des Historismus setzte sich nach den napoleonischen Kriegen die Neugotik durch. Sie entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu dem sogenannten Weichsel-Ostsee-Stil, der an die Backsteingotik Krakaus und Nordpolens anknüpfte. Wichtige Vertreter dieses Architekturstils waren Józef Pius Dziekoński, Teodor Talowski, Enrico Marconi, Piotr Aigner, Feliks Księżarski, Alexis Langer, Franciszek Jaszczołd, Ludwig Schneider, Jan Sas-Zubrzycki und Konstanty Wojciechowski. Zu den bedeutenden Bauwerken der Neugotik in Polen zählen der Dowspudaer Pac-Palast (nur Eingangsbereich erhalten), der Łeśkower Dachowski-Palast, de Starawieśer Radziwiłł-Palast, der Radziejowicer Gothische Schloss, das Opinogóraer Krasiński-Schloss, der Landwarówer Tyszkiewicz-Palast, der Kosówer Pusłowski-Palast, das Schloss Kórnik, das Schloss Kamenz, der Breslauer Hauptbahnhof, der Bahnhof Neu Skalmierschütz, das Haus der Warschauer Rudergesellschaft, das Warschauer Ławrynowicz-Haus die Krzeszowicer Martinskirche von Karl Friedrich Schinkel, das Collegium Novum der Jagiellonen-Universität, das Frankensteiner Rathaus, das Bromberger Hauptpostamt und die Posener Erlöserkirche. Beispiele für den Weichsel-Ostsee-Stil sind die Warschauer Michaelsbasilika, die Krakauer Josefskirche, die Radomer Marienkathedrale, die Białystoker Marienbasilika, die Lemberger Elisabethkirche und die Żyrardówer Marienkirche.
Die Neuromanik setzte sich später durch als die Neugotik. Sie spielte gegenüber letzterer eine untergeordnete Rolle und setzte sich nur im preußischen Landesteil wirklich durch. Zu den wichtigsten Baudenkmälern der Neuromanik in Polen zählen insbesondere das Posener Kaiserschloss, das Schloss Juditten, das Danziger Akademische Gymnasium, die Krypta verdienter Polen auf dem Skałkahügel, die Warschauer Nożyk-Synagoge, die Buker Synagoge sowie die nicht mehr erhaltenen schlesischen Synagogen in Gleiwitz, Myslowitz, Cosel, Kreuzburg und Ratibor, die Ostrower Stanislauskonkathedrale, die Breslauer Augustinuskirche, die Beuthener Barbarakirche, die Zakopaner Heilige Familie, die Warschauer Katherinenkirche, die Neusalzer Antoniuskirche, die Friedenshütter Pauluskirche, die Oppelner Peter- und Paulskirche, die Thorner Dreifaltigkeitskirche, die Wszembórzer Nikolauskirche, die Zabrzer Annakirche, das Breslauer Städtische Hallenbad, das Nimptscher Rathaus und das Stettiner Nationalmuseum.
Die Neorenaissance setzte in Polen zeitgleich mit der Neuromanik ein, erreichte ihren Höhepunkt jedoch erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der führende Architekt der Neorenaissance in Kongresspolen war der gebürtige Italiener Enrico Marconi. Er schuf im neuen Stil unter anderem den Warschauer Wiener Bahnhof, die Warschauer Karlskirche, die Wilanówer Annakirche, die Warschauer Allerheiligenkirche und das Warschauer Europahotel. Als weitere Beispiele der Neorenaissance in Polen gelten der Uruski-Palast, der Markiewicz-Viadukt, die Krakauer Wissenschaftsbibliothek, der Thorner Artushof, das Posener Collegium Chemicum, das Bielitzer Rathaus, das Landeshuter Rathaus, das Stargarder Rathaus, das Stettiner Woiwodschaftsamt, das Krakauer Bonerowska-Haus, das Zabrzer Hauptpostamt, der Hauptbahnhof Sosnowiec, das Schloss Neudeck, der Breslauer Kornów-Palast, der Krakauer Puget-Palast. Eine Abwandlung der Neorenaissance war der Arkadenstill, in dem unter anderem die Kattowitzer Auferstehungskirche, die Szamociner Peter- und Paulskirche, die Drohobytscher Choral-Synagoge und das Warschauer Hotel Bristol erbaut wurde. Besonders reich an Neorenaissance-Architektur ist Łódź und hier insbesondere die Petrikauer Straße, so zum Beispiel mit dem Maurycy-Poznański-Palast, dem Karol-Poznański-Palast, dem Karl-Wilhelm-Scheibler-Palast, dem Ludwika-Geyer-Haus, dem Scheibler-Palast, dem Steinert-Palast, dem Arnold-Stiller-Palast, dem Haus der Städtischen Kreditanstalt.
Der Neobarock folgte der Neorenaissance in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Stefan Szyller, der zunächst im Stil der Neorenaissance baute, war wohl der bekannteste Vertreter des Neobarocks in Polen. Sein bekanntestes Bauwerk in diesem Stil ist die Galerie Zachęta im Zentrum Warschaus, das allerdings teilweise auch bereits zum Eklektizismus gezählt wird. In Bydgoszcz war dagegen Józef Święcicki tätig, der zahlreiche Mietshäuser im Stil des Neobarock entwart, wie zum Beispiel das Adlerhotel, das Święcicki-Haus, das Hecht-Haus, das Wolności-Haus. Weitere bedeutende Beispiele für den Neobarock in Polen sind das Schloss Pleß, das Schloss Kochcice, das Schloss Smolice, der Warschauer Kronenberg-Palast (im Zweiten Weltkrieg ausgebrannt und bisher nicht wieder aufgebaut), der Warschauer Leszczyński-Palast, der Stettiner Pommersche Landtag, das Bielitzer Adlerhotel, das Teschener Hirschhotel, die Bromberger Dreifaltigkeitskirche, das Breslauer Puppentheater, das Breslauer Landeshaus, das Görlitzer Kulturhaus, das Sanoker Rathaus, das Nowogarder Rathaus, das Plesser Rathaus, das Thorner Horzycy-Theater die Thorner Heiliggeistkirche, die Friedlander Dreifaltigkeitskirche sowie das Bad Landecker Adalbert-Sanatorium.
Als letzte Stilrichtung des Historismus kam der Eklektizismus in dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts nach Polen, der sich durch die Vermischung der anderen Architekturstile des Historismus kennzeichnete. Das bekannteste Bauwerk des Eklektizismus in Polen ist das Krakauer Słowacki-Theater. Im gleichen Stil sind auch das Bielitzer Polnische Theater, das Teschener Mickiewicz-Theater, der Łódźer Izraela-Poznański-Palast, das Bielitzer Schloss, der Bielitzer Hauptbahnhof, das Neusandezer Rathaus, das Bad Landecker Rathaus, das Jaroslauer Rathaus, das Lubliner Grand Hotel Lublinianka, die Augustówer Heilig-Herz-Basilika, die Warschauer Erlöserkirche, das Hauptgebäude der Technischen Universität Warschau, die Warschauer Philharmonie (im Zweiten Weltkrieg zerstört und nicht mehr originalgetreu aufgebaut), das Warschauer Foksal-Haus, das Warschauer Sommertheater (im Zweiten Weltkrieg zerstört und bisher nicht wieder aufgebaut), das Łódźer Ladnau-Haus, die Ernst-Leonhardt-Villa, der Juliusz-Heinzl-Palast und die Krakauer KOMK-Bank gebaut worden.
Junges Polen
Der Jugendstil kam relativ früh in die polnischen Teilungsgebiete, entwickelte sich jedoch in den verschiedenen Landesteilen je nach politischer Zugehörigkeit zu Deutschland, Russland oder Österreich-Ungarn sehr unterschiedlich. Eine eigene Spielart der Wiener Secession, Junges Polen genannt, entwickelte sich in Galizien, insbesondere in Krakau. Wichtige Vertreter der Sezession waren Franciszek Chełmiński, Dawid Lande, Franciszek Mączyński, Franciszek Ruszyc und Gustaw Landau-Gutenteger. In der Bergregion Podhale entwickelte Stanisław Witkiewicz um 1890 den Zakopane-Stil. Weitere bedeutende Zentren des Jugendstils waren Łódź, Warschau, Bydgoszcz, Bielsko-Biała und Oberschlesien.
Bedeutende Beispiele der Sezession in Polen sind der Oppolner Ceresbrunnen. das Bielitzer Froschhaus, das Hirschberger Norwid-Theater, die Krakauer Jesu-Herz-Kirche, das Krakauer Haus unter dem Globus, das Krakauer Haus unter der Spinne, die Krakauer Michaliks Höhle, der Krakauer Kunstpalast, das Krakauer Altes Theater, das Collegium Witkowski, das Krakauer Czyncielów-Haus, die Krakauer Handelskammer, das Krakauer Sokół-Haus, das Jarosławer Sokół-Haus, die Łódźer Esplanada, das Łódźer Wilhelm-Landau-Bankhaus, das Warschauer Wilhelm-Landau-Bankhaus, die Łódźer Kaufmannsschule, das Łódźer Oszera-Kohn-Haus, die Łódźer Leon-Rappaport-Villa, das Łódźer Schychtów-Haus, das Łódźer Zygmunt-Dejczman-Haus, das Łódźer Izrael-Poznański-Mausoleum, die Łódźer Leopold-Kindermann-Villa, der Neusandezer Bahnhof, das Płocker Masowisches Museum, das Breslauer Grosshandelshaus Schlesinger & Grünbaum, die Beuthener Georg-Brüning-Villa, die Beuthener IV Lyzeum, das Zabrzer Adlerhaus, das Palais Nowik, das Hallenschwimmbad Breslau, das Breslauer Handelshaus Barasch, das Breslauer Hotel Monopol, die Breslauer Markthalle, die Technische Universität Breslau, der Wasserturm Breslau, das Warschauer Hotel Rialto, das Warschauer Hotel Savoy, die Przemyśler Neue Synagoge und das Bromberger Copernicanum.
Zwischenkriegszeit
Einer der wichtigsten polnischen Architekten der Zwischenkriegszeit war Adolf Szyszko-Bohusz, der unter anderem das Weichsler Präsidentenschloss. Der Erste Weltkrieg brachte viele Zerstörungen in Südpolen. Viele öffentliche Gebäude wurden im Art-déco-Stil, Funktionalismus und Modernismus wiederaufgebaut oder neu gebaut. Hierzu zählen zum Beispiel das neue Sejmgebäude, das Warschauer Prudential-Hochhaus, das Warschauer Haus ohne Ecken, das Warschauer Landeswirtschaftsbank, das Hauptgebäude der Warsaw School of Economics, das Gebäude der Polnischen Wertpapierdruckerei, das Warschauer Kommunikationsministerium, das Warschauer Gebäude des Fernmeldeamtes, die Pferderennbahn Służewiec, das Breslauer Warenhaus Wertheim, die Nationalmuseen in Warschau und Krakau, die Jagiellonische Bibliothek, die Zabrzer Josephskirche, die Breslauer Gustav-Adolf-Kirche, das Breslauer Kaufhaus Rudolf Petersdorff, die Stettiner Heilige-Familie-Kirche, die Białystoker Rochuskirche, die Seefahrt-Akademie Gdynia, der Kattowitzer Wolkenkratzer oder die Kattowitzer Christkönigskathedrale. Ein bedeutendes Gebäude des Modernismus, das bereits vor dem Ersten Weltkrieg entstand, ist die Breslauer Jahrhunderthalle.
Sozrealismus
Die bisher größte Zerstörung der polnischen Bausubstanz brachte der Zweite Weltkrieg. Warschau wurde systematisch zerstört, die Baudenkmäler in Ostpolen kamen an die Sowjetunion und alle größeren Städte Polens bis auf Krakau wurden durch Kriegshandlungen erheblich beschädigt. Der Wiederaufbau in der Nachkriegszeit wurde mustergültig aufgenommen – die polnischen Restauratoren genießen Weltruhm – und ist aber auf absehbare Zeit nicht abzuschließen. Die Altstadt und die Neustadt von Warschau sowie das Weichselviertel Mariensztat wurde in den 1970er Jahren und das Königsschloss in den 1980er Jahren wiederaufgebaut. Die UNSESC würdigte die Leitung der polnischen Restauratoren mit der Aufnahme der wiederaufgebauten Altstadt in das Weltkulturerbe im Jahr 1980. Die Bausubstanz des 19. Jahrhunderts im Zentrum um die Marszałkowska-Straße, die Aleje Jerozolimskie und die Świętokrzyska-Straße scheinen aber für immer verloren. An ihrer Stelle entstanden monumentale Gebäude im Stil des Sozrealismus, allen voran der Kulturpalast, der Warschauer Platz der Verfassung und das Vorzeigeviertel MDM. Auch in Breslau, Danzig, Stettin und Posen wurden die Altstädte zum großen Teil originalgetreu wieder aufgebaut. Den Zweiten Weltkrieg relativ unversährt haben dagegen Krakau, Łódź und Lublin sowie die nach der Westverschiebung Polens nunmehr zur Sowjetunion gehörenden Städte Lemberg und Wilna.
Weitere bedeutende Gebäude des Sozrealismus in Polen sind das Białystoker Parteigebäude, das Königshütter Schlesische Planetarium, der Dombrowaer Kohlenbeckener Kulturpalast, der Hauptbahnhof Gdynia, das Kattowitzer Gewerkschaftshaus, der Kattowitzer Jugendpalast, das Krakauer Collegium Chemicum, das Hauptgebäude der Wissenschaftlich-Technische Universität Krakau, das Krakauer Viertel Nowa Huta mit dem Zentralplatz, der Allee der Rosen und dem Kino Światowid, das Łódźer Große Theater, das Rzeszówer Appellationsgericht, das Rzeszówer Musikinstitut, das Warschauer Finanzministerium, das Warschauer Landwirtschaftsministerium, das Warschauer Grand Hotel, das Warschauer Regierungskabinettsgebäude, die Russische Botschaft in Warschau, das Warschauer Meteorologieinstitut, das Großendorfer Fischerhaus und das Zabrzer Haus der Musik und des Tanz. Während der Volksrepublik entstanden auch neben dem Kulturpalast weitere Wolkenkratzer in der Warschauer Innenstadt, wie die Hochhäuser der Ostwand, das Novotel Warszawa Centrum, das Intraco I, das Centrum LIM und der Oxford Tower.
Gegenwartsarchitektur
Der Wiederaufbau nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs ging nach dem Ende der Volksrepublik weiter, wenn auch nicht mehr so originalgetreu wie in den 1940er und 1950er Jahren. Einige Paläste sind in den 1990er Jahren wieder erstanden, als Beispiel kann hier der Jabłonowski-Palast gelten. Es wurde jedoch nur die Fassade originalgetreu aufgebaut, während im Inneren ein modernes Bürogebäude entstand. Demnächst soll mit dem Wiederaufbau der Sächsischen und Brühlschen Paläste und der Wiedererrichtung der Gärten des Königsschlosses begonnen werden.
In den 1990er Jahren begann ein Bauboom von Wolkenkratzern, die von namhaften Architekten wie beispielsweise dem Engländer Norman Foster und dem Amerikaner polnischer Herkunft Daniel Libeskind entworfen wurden. Insbesondere die westliche Innenstadt entlang der Johannes-Paul-II.-Allee und das sich im Westen anschließende Viertel Wola ist von moderner Architektur umgeben. Zu den interessantesten neuen Gebäuden gehören das Warsaw Spire, der Warsaw Trade Tower, das Q22, das Rondo 1-B, die Złota 44, das Warsaw Financial Center, das InterContinental, das Cosmopolitan Twarda 2/4, der TP S.A. Tower, das Blue Tower Plaza, der ORCO Tower, das Millennium Plaza, die Goldenen Terrassen, das Ilmet, der PZU Tower, das Hotel The Westin Warsaw und das Plac Unii. Weitere Wolkenkratzer sind in Kattowitz (unter anderem das Altus, ), Krakau (unter anderem das K1 (Krakau) und der derzeit umgebaute Unity Tower) in Breslau (unter anderem der Sky Tower), in Posen (unter anderem der Andersia Tower und das Poznań Financial Centre) in der Dreistadt Danzig-Gdynia-Sopot (unter anderem die Sea Towers und der Neptun) und in Stettin (unter anderem das Pazim) entstanden. Bemerkenswert sind auch Norman Fosters Warschauer Metropolitan, die Warschauer Świętokrzyski-Brücke, die Warschauer Siekierkowski-Brücke, das das umgebaute und ausgebaute Gebäude des Warschauer Museum des Warschauer Aufstandes, das Gebäude des Warschauer Museums der Geschichte der polnischen Juden POLIN, das Krakauer Gebäude des Museums der Japanischen Kunst und Technik Manggha, das Warschauer Wissenschaftszentrum Kopernikus und das Gebäude des Danziger Museums des Zweiten Weltkriegs sowie das Gebäude des Danziger Europäischen Zentrums der Solidarność.
Zu den neuen sakralen Gebäuden zählen Tempel der Göttlichen Vorsehung in Warschau, das Sanktuarium der Barmherzigkeit Gottes und die Johannes-Paul-II-Kirche in Krakau sowie die Basilika der Muttergottes von Licheń in Stary Licheń.
Im Bau befindet sich neben dem nach Fertigstellung höchsten Gebäude in der Europäischen Union Varso Tower auch die Nowa Emilia, der Spinnaker, der Skyliner, der Port Praski, der Mennica Legacy Tower, der Spark, das The Warsaw Hub, das B4 Office Center, das J44, der Unique Tower, das Aura Sky und Chmielna 89.
Film
Die Geschichte des polnischen Films reicht in die Jahre 1894–1896 zurück, als Kazimierz Prószyński den Pleographen erfand, mit dem er kleine Szenen des Alltags in Warschau filmte. Als erster bekannte polnische Filmaufzeichnung gilt die Szene Ślizgawka w Łazienkach mit Schlittschuhfahrern im Warschauer Łazienki-Park. Der Kameramann Bolesław Matuszewski realisierte kleinere Dokumentarfilme im Auftrag der französischen Firma der Brüder Lumière. Weitere bekannte Filmschaffende der Anfangszeit waren Antoni Fertner und Pola Negri. In der Zwischenkriegszeit produzierten Ryszard Ordyński, Adolf Dymsza, Jan Kiepura, Wanda Jakubowska und Eugeniusz Bodo. In der Volksrepublik waren zudem Leonard Buczkowski, Andrzej Munk, Tadeusz Konwicki, Jerzy Kawalerowicz, Wojciech Has, Roman Polański, Marek Piwowski, Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, Stanisław Bareja, Kazimierz Karabasz, Jerzy Bossak, Krzysztof Zanussi, Juliusz Machulski, Kazimierz Kutz, Agnieszka Holland, Aleksander Ford, Jerzy Toeplitz, Walerian Borowczyk, Jan Lenica, Witold Giersz, Ryszard Bugajski, Filip Bajon, Jerzy Hoffman, Stefan Themerson und Andrzej Żuławski tätig. In Łódź entstand die Polnische Filmschule. Seit dem 1970er Jahren findet das Polnische Filmfestival in Gdynia statt. Der gegenwärtige polnische Film mit Regisseuren, wie Władysław Pasikowski, Krzysztof Krauze, Sławomir Fabicki, Robert Gliński, Marek Koterski, Feliks Falk, Piotr Trzaskalski und Jan Komasa, findet weltweit Anerkennung. Seit 1999 wird der Polnische Filmpreis vergeben.

Pola Negri

Eugeniusz Bodo

Jan Kiepura

Zbigniew Cybulski

Roman Polański

Stanisław Bareja
Andrzej Wajda

Beata Tyszkiewicz
Barbara Kwiatkowska
Medien
Die polnische Medienlandschaft ist stark polarisiert, wobei sich Medienunternehmen, die eine wirtschafts- und werteliberale Linie vertreten, und Verlage sowie andere Medienunternehmen, die sich für einen Ausbau des Sozialstaats und konservative Werte einsetzen, gegenüberstehen. Auffallend ist dabei, dass die liberalen Medienunternehmen vor allem von ausländischen Anteilseignern gehalten werden, während die sozial-konservativen Verlage vor allem durch polnisches Kapital finanziert werden. So ist zum Beispiel an der Agora S.A., dem Herausgeber der linksliberalen Tageszeitung Gazeta Wyborcza und zahlreichen Radiosendern wie Tok FM, der US-Amerikaner George Soros über seine Stiftungen beteiligt. Die deutschen beziehungsweise deutsch-schweizerischen Verlage Ringier Axel Springer Media, die Verlagsgruppe Passau sowie die Bauer Media Group geben die ebenfalls liberalen Printmedien Fakt, Newsweek Polska sowie fast alle regional erscheinenden Zeitungen heraus und besitzen zahlreiche Internetportale wie Onet.pl und Interia.pl sowie Radiosender wie RMF FM. Der Anteilseigner Grupa TVN der liberalen Sendergruppe TVN wird vom US-amerikanischen Medienunternehmen Discovery Communications gehalten. Auf der anderen Seite werden die konservativen Printmedien von polnischen Verlagen wie Instytut Gość Media (Gość Niedzielny), Fratria (wSieci), Orle Pióro (Do Rzeczy), Niezależne Wydawnictwo Polskie (Gazeta Polska und Gazeta Polska Codzinne) und den Warschauer Redemptoristen (Radio Maryja, TV Trwam und Nasz Dziennik) herausgegeben. Zu den polnischen konservativen Medien gehört auch der Sender Telewizja Republika, ein Gemeinschaftsprojekt verschiedener Medienunternehmen, sowie die Internetportale niezalezna.pl, wpolityce.pl und fronda.pl. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk gilt seit seiner Entstehung in der Volksrepublik als stets regierungsnah, was bei markanten Regierungswechseln stets zur Auswechslung eines großen Teils der Kader führt, so 2005–2006, 2008–2010 und 2015–2016 geschehen.
- Fernsehen

TVP-Zentrale in Warschau
Neben den öffentlich-rechtlichen Fernsehkanälen von Telewizja Polska (TVP; dt. Polnisches Fernsehen) gibt es zwei weitere ebenfalls landesweit und flächendeckend empfangbare bedeutsame private Fernsehkanäle: TVN und Polsat.
Bis 1992 besaß nur das öffentlich-rechtliche Fernsehen eine Sendeerlaubnis. 1992 kam Polsat hinzu, 1997 folgte TVN.[103]
Der polnische Fernsehmarkt hat sich seit den 1990er Jahren bis heute kontinuierlich weiterentwickelt, sodass die früheren wichtigsten Anbieter TVP, TVN und Polsat von einzelnen Kanälen zu Paketen aus mehreren Kanälen ausgebaut wurden. So findet man in jedem Paket jedes Anbieters zusätzlich auch einen Nachrichten-, Kultur-, Dokumentation-, Spielfilm- und Sportsender.
Die Landschaft an öffentlich-rechtlichen regionalen Kanälen ist der in Deutschland ähnlich. Es gibt 16 selbstständige staatliche Kanäle mit regionaler Ausrichtung (Die Dritten).
Fernsehsender mit dem größten Marktanteil war 2012 TVP1 mit 15,41 Prozent. Es folgten Polsat (13,97 %), TVN (13,93 %) und TVP2 (12,56 %).[104]
- Hörfunk

Trójka in Krakau
Die öffentlich-rechtliche polnische Hörfunkanstalt Polskie Radio betreibt die drei wichtigsten landesweit empfangbaren staatlichen Radioprogramme. Diese sind Jedynka (Das Erste) mit Schwerpunkt auf Politik, Kultur, Reportagen, Dwójka (Das Zweite) als Kultursender sowie Trójka (Das Dritte) vor allem für jüngere Menschen. Es wird auch ein dichtes Netz aus 17 staatlichen regionalen Radiosendern betrieben. Die staatliche Rundfunkanstalt hat in den 1990er Jahren ernstzunehmende Konkurrenz durch die privaten Radiosender Radio Zet (ein landesweiter Sender) und RMF FM (Netz aus etwa 20 regionalen Sendern) bekommen, die sich bei 15- bis 35-Jährigen größter Beliebtheit erfreuen.
Eine Besonderheit der polnischen Medienlandschaft ist die Existenz stark religiös ausgerichteter Sender, wie TV Trwam und Radio Maryja, die in katholisch-konservativen Kreisen gehört werden.
Den größten Marktanteil konnte 2004 RMF FM mit 23,95 Prozent verbuchen. Es folgten Radio Zet (21,41 %), Polskie Radio 1 (15,51 %), Polskie Radio 3 (5,32 %) und Radio Maryja (2,39 %).[105]
Die Hörfunk- und Fernsehsender werden von einer staatlichen Aufsichtsbehörde, der Rada Mediów Narodowych (dt. Rat Nationaler Medien) lizenziert und überwacht.
- Print- und Internetmedien
Auflagenstärkste überregionale Tageszeitungen sind die Boulevardzeitungen Fakt und Super Express sowie die Gazeta Wyborcza und Rzeczpospolita. Sämtliche Tageszeitungen haben in den letzten Jahren an Lesern verloren, insbesondere die Gazeta Wyborcza ist von einer ursprünglichen Auflagenzahl von knapp einer halben Million auf ca. 100.000 im Oktober 2017 gefallen.
Zu den auflagenstärksten meinungsbildenden Wochenmagazinen gehören Gość Niedzielny, Polityka, Newsweek Polska und Sieci. Die wichtigste polnische Presseagentur ist die Polska Agencja Prasowa (PAP). Für englischsprachige Leser erscheinen die Warsaw Voice und das Warsaw Business Journal. In der Vergangenheit gab es die deutschsprachige polen-rundschau.
1990 gab es 3007 Zeitschriften, die Zahl wuchs bis 1999 auf 5444. Die Zahl der Tageszeitungen sank von 1990 bis 2000 von 130 auf 66. Auflagenstärkste war 2004 Fakt.[106]
Die bekanntesten Internetportale sind Onet.pl, Wirtualna Polska und Interia.pl.
2016 nutzten ca. 28 Millionen Polen das Internet (72,4 % der Bevölkerung).
Bräuche

Wianki nach Siemiradzki

Krakauer Lajkonik
Nationale und regionale Bräuche werden vor allem auf dem Land aufrechterhalten. Sie sind mit den verschiedenen Religionen, besonders der römisch-katholischen, verbunden. Wichtig sind die Feste der verschiedenen religiösen Gemeinschaften: Sternsinger, Kulig, Wigilia und Pasterka an Weihnachten, Friedhofsfeiern an Allerheiligen und Allerseelen Zaduszki, das Fronleichnamsfest in Łowicz, die Mysterienspiele in Kalwaria Zebrzydowska, das kaschubische Bootsfest, der Dominikaner Jahrmarkt in Danzig, das Sopot Festival und das Festival in Jarocin, der Fette Donnerstag vor Aschermittwoch das vorösterliche Eierkratzen, die Osterpalme an Palmsonntag in Lipnica Murowana, die Osterspeisensegnung am Karsamstag, das an Ostermontag stattfindetende Śmigus-dyngus und Siuda Baba, aber auch das orthodoxe Jordanfest in Drohiczyn und das muslimisch-tatarische Kurban Bajram in Bohoniki. Pilgerfahrten erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit, etwa die katholischen Wallfahrten nach Tschenstochau, Heiligelinde, Stary Licheń, Kalwaria Zebrzydowska, Łagiewniki und zum St. Annaberg, aber auch die jüdischen Grabbesuche der chassidischen Mystiker Elimelech aus Leżajsk und Moses Isserles aus Krakau, die orthodoxe Wallfahrt nach Grabarka, das Erntedankfest Dożynki und die Studentenfeste der Juwenalia. Polnische Abiturienten begehen hundert Tage vor der Abiturprüfung das Fest Studniówka.
Viele der lokalen Bräuche und Riten stehen in Zusammenhang mit den Jahreszeiten (z. B. die Zuwasserlassung der Wianki, die Versenkung der Marzanna und der Krakauer Lajkonik). Kunstwerke, die mit den Bräuchen verbunden sind, umfassen die Ikonenmalerei vor allem in Podlachien, Lublin und dem Karpatenvorland, Schnitzereien mit religiösen (Jezus Frasobliwy) und weltlichen Motiven sowie die Stickereien – Koronki. Bekannt sind auch Trachten, insbesondere die aus Krakau und die der Goralen. Von den traditionellen Bräuchen in der Architektur sind die Wegkapellen zu nennen, vor allem in den Beskiden und Masowien. Verbunden mit dem polnischen Brauchtum sind auch die traditionelle Musik (jüdische Klezmer, Kammermusik, Mazurkas, Polonaisen, Krakowiaks und Polkas) sowie der Tanz (u. a. die Tanzensembles Mazowsze, Śląsk und Słowianki), das traditionelle Theater sowie die Mundartdichtung der Goralen, Kaschuben und Schlesier. Zu den besonders traditionsreichen Regionen gehören Kurpie und Podhale. Zalipie in Kleinpolen ist bekannt für seine mit Lüftlmalerei bemalten Blumenhäuser. Die erwachsenen Polen begehen den Namenstag in größerem Umfang als den Geburtstag, der eher von Kindern in Polen gefeiert wird.
Küche

Barszcz mit Uszka
Die polnische Küche ist vielschichtig und vor allem mit den Küchen der östlichen Nachbarländer Polens verwandt, weist aber auch zu den mitteleuropäischen und skandinavischen Küchen einige Parallelen auf. In den Eigenheiten der polnischen Küche spiegeln sich die historische Adelskultur und die bäuerliche Kultur des Landes ebenso wider wie seine geographischen Gegebenheiten. Daneben gibt es viele traditionelle Bräuche der Lebensmittelherstellung, wie z. B. der Schafskäse Oscypek und die Bryndza der Góralen aus der Region Podhale, die Krakauer Brezel Obwarzanek und Krakauer Würste sie die großpolnischen Pyzy. Kabanos ist eine weitere beliebte polnische Wurstsorte. Auch der in Nordamerika sehr populäre Bagel stammt ursprünglich aus Krakau, wo er 1610 zum ersten Mal in einer jüdischen Quelle urkundlich erwähnt wird. In den USA sind zudem polnische Wurtserzeugnisse sehr beliebt, die dort unter dem polnischen Namen Kielbasa oder einfach Polish Sausage vermarktet werden. Zu den bekanntesten polnischen Nationalgerichten gehören Pierogi, Żurek, Gołąbki, Kluski śląskie, Krokiet, Bigos, Zrazy, Flaki, Pulpety, Kopytka, Pampuchy, Kaszanka, Kotlet schabowy, Czernina und Barszcz mit Uszka. Da in Polen viel gejagt und geangeelt wird, stellen Wild und Fisch einen großen Bestandteil der polnischen Küche dar. Häckerle und Ryba po grecku sind traditionelle Fischgerichte. Als Saucen werden insbesondere die Polnischen Saucen verwendet. Beliebte Süßwaren sind die Thorner Lebkuchen, Posener Martinshörnchen, Pączki, Faworki, Kołaczyk, Kołacz, Mazurek, Placek, Babka, Racuchy, Kulebjak, Makiełki und Makówki. Tee und Kaffee sind die meistgetrunkenen nichtalkoholischen Getränke in Polen. Zu Mahlzeiten wird of Kompott oder Mineralwasser getrunken. Zu den meistgetrunkenen alkoholischen Getränken gehören Wodka und Bier. Wodka ist ein polnisches Nationalgetränk, der erste Wodka wurde in Südostpolen (Sandomierz) im Jahre 1405 hergestellt. Seit dem Mittelalter war in Polen der Honigwein Krupnik beliebt. Der Weinbau in Polen wird immer beliebter. In Polen gibt es immer mehr Winzer, die vor allem im Süden und Südosten Weinberge anlegen. In den Bar mleczny, öffentlich bezuschussten Kantinen, die sich oft in den Stadtzentren befinden, kann man regelmäßig traditionelle polnische Küche zu relativ niedrigen Preisen bekommen.
Freizeit

Kanus auf der Krutynia in Masuren
Aufgrund der vielen Seen und der langen sandigen Meeresküste sind Wassersportarten wie Segeln (u. a. Große Masurische Seen), Surfen (u. a. Hel), Tauchen (u. a. Danziger Bucht), Kajak (u. a. auf den Flüssen Krutynia, Czarna Hańcza, Drawa), Schwimmen und Angeln in Polen sehr beliebt. Hausbooturlaub ist auf den revitalisierten Wasserwegen auch ein touristischer Faktor geworden. Die Polen nutzen die vielen Wälder auch gerne zum Pilze sammeln. In den Bergen wird viel gewandert und Alpin Ski und Snowboard gefahren (u. a. Sudeten, Beskiden, Tatra). Rafting ist auf dem Gebirgsflüssen, vor allem dem Dunajec im Pieniny-Durchbruch, sehr beliebt. Auch Segel- und Ballonfliegen ist in den Beskiden populär. Langlauf, Hundeschlittenfahren und Eissegeln werden in den Waldkarpaten und Masuren praktiziert. An den verschiedenen international bedeutenden Straßenläufen nehmen zunehmend auch Volksläufer teil.[107][108] Das Schachspiel hat in Polen eine lange Tradition.
Sport

Mannschaft 2010

Nationalstadion Warschau
Wintersport spielt eine wichtige Rolle in Polen. Skispringen erfreut sich großer Beliebtheit. Für internationale Wettbewerbe genutzte Skisprungschanzen befinden sich in Zakopane (Wielka Krokiew und Średnia Krokiew) sowie in Wisła (Malinka). Zu den erfolgreichen polnischen Wintersportlern gehörten bzw. gehören die Skispringer Bronisław Czech, Władysław Tajner, Wojciech Fortuna, Adam Małysz, Marcin Bachleda, Kamil Stoch, Stefan Hula, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Piotr Żyła und Jan Ziobro, die Skirennläufer Andrzej Bachleda-Curuś, die Eisschnellläufer Katarzyna Bachleda-Curuś, Zbigniew Bródka, Artur Waś, Katarzyna Woźniak und Luiza Złotkowska, die Skilangläufer Józef Łuszczek, Justyna Kowalczyk, Dominik Bury und Martyna Galewicz und die Snowboarderin Paulina Ligocka-Andrzejewska.
Leichtathletik ist in Polen ebenfalls beliebt. Bei den Medaillenspiegeln der Leichtathletik-Weltmeisterschaften schneidet Polen in den letzten Jahren regelmäßig unter den Top-Ten ab. Zu den erfolgreichen polnischen Leichtathleten gehörten bzw. gehören Anita Włodarczyk, Robert Korzeniowski, Marcin Lewandowski, Artur Noga, Lidia Chojecka, Kamila Lićwinko, Anna Rogowska und Konrad Bukowiecki.
Schwimmen erfreut sich in Polen einer großen Beliebtheit. Otylia Jędrzejczak war die erfolgreichste polnische Schwimmerin.
Gleichwohl stehen beim polnischen Sportfan Fußball, Volleyball, Handball und Basketball am höchsten im Kurs. Der Polnische Fussballverband ist Organisator der Ekstraklasa und der nachgeordneten Ligen. Die Polnische Fußballnationalmannschaft wurde 1919 gegründet und gehörte in den 1970er und 1980er Jahren zu den besten Teams der Welt. Sie erreichte bei den Weltmeisterschaften 1974 und 1982 Platz drei sowie die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 1972 und die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 1976. Herausragende Spieler waren in dieser Zeit Grzegorz Lato, Zbigniew Boniek, Kazimierz Deyna, Robert Gadocha, Władysław Żmuda und Andrzej Szarmach. Zu den gegenwärtig bekanntesten Spielern aus Polen zählen Artur Boruc, Wojciech Szczęsny, Robert Lewandowski, Grzegorz Krychowiak, Łukasz Piszczek und Jakub Błaszczykowski.
Am 18. April 2007 wurde Polen zusammen mit der Ukraine von der UEFA zum Ausrichter der Fußball-Europameisterschaft 2012 bestimmt. Hierzu wurden vier neue Stadien in Warschau, Danzig, Posen und Breslau gebaut.
Seit 1996 findet jährlich im September das Herren-Tennisturnier ATP Challenger Stettin statt. Zu den erfolgreichen polnischen Tennisspielern gehörten bzw. gehören Wojciech Fibak, Mariusz Fyrstenberg, Jerzy Janowicz, Agnieszka Radwańska, Urszula Radwańska, Magdalena Fręch und Paula Kania.
Feiertage

Allerheiligen

Unabhängigkeitsmarsch
| 1. Januar | Neujahr (Nowy Rok) |
| 6. Januar | Heilige Drei Könige (Święto Trzech Króli) |
| März, April | Ostersonntag (Niedziela Wielkanocna) |
| März, April | Ostermontag (Poniedziałek Wielkanocny) |
| 1. Mai | Staatsfeiertag (Święto Państwowe) |
| 3. Mai | Tag der Verfassung vom 3. Mai 1791 (Święto Konstytucji Trzeciego Maja) |
| 7. Sonntag nach Ostern | Pfingsten (Zielone Świątki) |
| 9. Donnerstag nach Ostern | Fronleichnam (Boże Ciało) |
| 15. August | Mariä Aufnahme in den Himmel (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny), gleichzeitig Tag der Polnischen Armee |
| 1. November | Allerheiligen (Wszystkich Świętych) |
| 11. November | Unabhängigkeitstag (Dzień Niepodległości) |
| 25. Dezember | 1. Weihnachtsfeiertag (pierwszy dzień Bożego Narodzenia) |
| 26. Dezember | 2. Weihnachtsfeiertag (drugi dzień Bożego Narodzenia) |
Siehe auch
Literatur
Bundeszentrale für politische Bildung BpB, Bonn: Polen. Informationen zur politischen Bildung (PDF; 5,8 MB)
Deutsches Polen-Institut, Darmstadt: Jahrbuch Polen
Manfred Alexander: Kleine Geschichte Polens. Reclam, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-15-017060-1.
Dieter Bingen, Krzysztof Ruchniewicz (Hrsg.): Länderbericht Polen. Geschichte, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur. Campus, Frankfurt 2009, ISBN 978-3-593-38991-2 und BpB, Bonn 2009.- Dieter Bingen u. a. (Hrsg.): Erwachsene Nachbarschaft. Die deutsch-polnischen Beziehungen 1991 bis 2011. Harrassowitz, Wiesbaden 2011, ISBN 978-3-447-06511-5.
Włodzimierz Borodziej: Geschichte Polens im 20. Jahrhundert. Beck, München 2010, ISBN 978-3-406-60648-9.- Andrzej Chwalba: Kurze Geschichte der Dritten Republik Polen. 1989 bis 2005. Harrasowitz, Wiesbaden 2009, ISBN 978-3-447-05925-1.
Norman Davies: Im Herzen Europas. Geschichte Polens. 4. Aufl. München 2006, ISBN 978-3-406-46709-7.- Jürgen Heyde: Geschichte Polens. 3. Aufl. München 2011, ISBN 978-3-406-50885-1.
- Brigitte Jäger-Dabek: Polen. Ein Länderporträt. 3. Auflage, Berlin 2012, ISBN 978-3-86153-701-4.
Matthias Kneip / Manfred Mack (Hrsg.): Polnische Gesellschaft. Berlin 2012, ISBN 978-3-06-064113-0.- Matthias Kneip et al.: Polnische Geschichte und deutsch-polnische Beziehungen. Berlin 2009, ISBN 978-3-06-064215-1.
Radek Knapp: Gebrauchsanweisung für Polen. München 2005, ISBN 978-3-492-27536-1.
Hartmut Kühn: Das Jahrzehnt der Solidarność. Die politische Geschichte Polens 1980–1990. Berlin 1999, ISBN 3-86163-087-7.
Steffen Möller: Viva Polonia. Als deutscher Gastarbeiter in Polen. 4. Auflage, Frankfurt 2009, ISBN 978-3-596-18045-5.- Stefan Muthesius: Kunst in Polen – Polnische Kunst 966-1990. Eine Einführung. Königstein im Taunus 1994, ISBN 3-7845-7610-9.
- Jacek Raciborski / Jerzy J. Wiatr: Demokratie in Polen. Elemente des politischen Systems, Opladen 2005, ISBN 3-938094-15-X.
Hartmut Kühn: Polen im Ersten Weltkrieg: Der Kampf um einen polnischen Staat bis zu dessen Neugründung 1918/1919, Peter Lang Verlag Berlin 2018, ISBN 9783631765302
Roland Walter: Geologie von Mitteleuropa. 7. Auflage. Schweizerbart, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-510-65225-9, S. 124–138.
Klaus Ziemer: Das politische System Polens. Eine Einführung. Springer Fachmedien, Wiesbaden 2013, ISBN 978-3-531-94028-1.
Weblinks
- Online-Dossier „Polen“ der Bundeszentrale für politische Bildung
- Polen-Analysen: Einschätzungen aktueller politischer, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Entwicklungen in Polen
Website der polnischen Regierung (mehrsprachig)- Główny Urząd Statystyczny (Polnisches Statistikamt)
- Länder und Reiseinformationen des Auswärtigen Amts
Einzelnachweise
↑ Polen bei Ethnologue
↑ wolframalpha.com
↑ [1] des Internationalen Währungsfonds
↑ [2] United Nations Development Programme (UNDP),
↑ Norman Davies: Europe: A History. Pimlico 1997, S. 554: Poland-Lithuania was another country which experienced its 'Golden Age' during the sixteenth and early seventeenth centuries. The realm of the last Jagiellons was absolutely the largest state in Europe.
↑ Przemysław Urbańczyk: Początki Polski do poprawki. 29. August 2008 auf focus.pl.
↑ Krystyna Długosz-Kurczabowa: Polska – Jaka jest etymologia słowa Polska (nazwa kraju)?, Wydawnictwo Naukowe PWN, 21. Februar 2003
↑ abc Główny Urząd Statystyczny: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010. Juni 2010 (Memento vom 15. November 2010 im Internet Archive), abgerufen am 23. Juli 2010.
↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Landeskunde. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 8–9.
↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Landeskunde. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 8.
↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Landeskunde. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 82.
↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Landeskunde. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 83.
↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Landeskunde. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 87–89.
↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Landeskunde. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 90.
↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Landeskunde. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 93–94.
↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Landeskunde. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 53.
↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Landeskunde. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 57, Tabelle 3.
↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Landeskunde. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 57.
↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Landeskunde. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 59.
↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Landeskunde. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 94–95.
↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Landeskunde. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 59–96.
↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Landeskunde. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 96.
↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Landeskunde. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 96–97.
↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Landeskunde. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 97.
↑ Dieter Bringen, Krzysztof Ruchniewicz (Hrsg.): Länderbericht Polen. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2009, ISBN 978-3-593-38991-2, S. 322.
↑ Im Reich der Hünen. Berliner Zeitung, 21. Juni 2003 (abgerufen am 22. September 2013)
↑ ab Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Landeskunde. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 62–63.
↑ abcde Portal der Republik Polen, Klima, abgerufen am 11. Juli 2010.
↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Landeskunde. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 47–49.
↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Landeskunde. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 43.
↑ ab Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Landeskunde. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 44.
↑ Wieder mehr (kleine) Polen. Polskie Radio, 29. Jan. 2009 (WebCite (Memento vom 29. Januar 2009 auf WebCite)).
↑ The World Factbook — Central Intelligence Agency. Abgerufen am 13. Juli 2017 (englisch).
↑ The World Factbook – Central Intelligence Agency. Abgerufen am 2. August 2017 (englisch).
↑ ab Ergebnis der Volkszählung 2011, Główny Urząd Statystyczny: Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Warschau, März 2012. Online (PDF)
↑ Dieter Bringen, Krzysztof Ruchniewicz (Hrsg.): Länderbericht Polen. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2009, ISBN 978-3-593-38991-2, S. 362.
↑ Artikel 35 der Verfassung der Republik Polen vom 2. April 1997.
↑ Die Prozentzahlen in Klammern spiegeln die alleinige Identifikation wider.
↑ Dieter Bringen, Krzysztof Ruchniewicz (Hrsg.): Länderbericht Polen. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2009, ISBN 978-3-593-38991-2, S. 363.
↑ Deutschland Auswanderung im Jahr 2010. auf: auswandern-info.com
↑ Arabowie i muzułmanie w Polsce. Sprawdziliśmy, ilu ich z nami mieszka Arabowie i muzułmanie w Polsce. Sprawdziliśmy, ilu ich z nami mieszka. Abgerufen am 16. September 2015.
↑ abcdefgh Władysław Lubaś, Monika Molas, Imke Mendoza (Übersetzung): Polnisch. In: Wieser-Enzyklopädie des europäischen Ostens / Bd. 10. Lexikon der Sprachen des europäischen Ostens, S. 367–389 (PDF; 689 kB).
↑ Reservations and Declarations for Treaty No.148 – European Charter for Regional or Minority Languages. Council of Europe, abgerufen am 19. Mai 2017.
↑ Religiöser und spiritueller Glaube, Bundeszentrale für politische Bildung, abgerufen am 1. Oktober 2016.
↑ Special Eurobarometer pdf., abgerufen am 1. Oktober 2016 (PDF).
↑ Główny Urząd Statystyczny: Mały rocznik statystyczny Polski 2012. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2012, S. 117, 134–135 (online [PDF; abgerufen am 15. Januar 2013]).
↑ ab Dieter Bringen, Krzysztof Ruchniewicz (Hrsg.): Länderbericht Polen. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2009, ISBN 978-3-593-38991-2, S. 373.
↑ Robert Żurek, Markus Krszoska (Übersetzer): Karol Wojtyła. In: Dieter Bringen, Krzysztof Ruchniewicz (Hrsg.): Länderbericht Polen. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2009, ISBN 978-3-593-38991-2, S. 400–403.
↑ Dieter Bringen, Krzysztof Ruchniewicz (Hrsg.): Länderbericht Polen. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2009, ISBN 978-3-593-38991-2, S. 378.
↑ abc Główny Urząd Statystyczny: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010. Warschau 2010, ISSN 1640-3630, S. 130–131 (online (Memento vom 15. November 2010 im Internet Archive)).
↑ Vgl. Wiktor Marzec: Die Revolution 1905 bis 1907 im Königreich Polen – von der Arbeiterrevolte zur nationalen Reaktion. In: Arbeit – Bewegung – Geschichte, Heft III/2016, S. 27–46.
↑ Małgorzata Fuszara: Polish Women's Fight for Suffrage. In: Blanca Rodríguez-Ruiz, Ruth Rubio-Marín (Hrsg.): The Struggle for Female Suffrage in Europe. Voting to Become Citizens. Brill Verlag Leiden, Boston 2012, ISBN 978-90-04-22425-4, Seite 143–157, S. 150.
↑ Polen beziffert Zahl seiner Weltkriegstoten neu. Der Standard, 26. August 2009.
↑ Zahlenangabe der Encyclopedia Britannica, abgedruckt bei: John Correll: Casualties, in: Air Force Magazine (Juni 2003), S. 53.
↑ Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa. Bundesministerium für Vertriebene, Bonn 1953, S. 78, 155.
↑ Einen Vergleich zwischen Privatisierung und Wirtschaftstransformation in Polen und der ehemaligen DDR leistet Jörg Roesler: Mit oder gegen den Willen der Betriebsbelegschaften? Die Privatisierung in Polen und den neuen Bundesländern 1990 bis 1995 im Vergleich. In: Jahrbuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung, Heft II/2015.
↑ Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
↑ tagesschau.de: USA verlegen 1000 Soldaten nach Polen. Abgerufen am 13. Juli 2017.
↑ Countries Ranked by Military Strength (2016) Globalfirepower, abgerufen am 17. Oktober 2015
↑ Rüstungsausgaben weltweit: Amerika gibt weniger, Osteuropa mehr für Waffen aus. Abgerufen am 17. Oktober 2015
↑ ab Główny Urząd Statystyczny: Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r., Warszawa 2013.
↑ data.worldbank.org
↑ abc IWF – World Economic Outlook Database: Report for Selected Countries and Subjects. Abgerufen am 28. Januar 2012.
↑ Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in KKS. Eurostat, 1. Juni 2016, abgerufen am 4. Dezember 2016.
↑ Regiony Polski – Regions of Poland. (PDF; 2,5 MB) Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009, abgerufen am 22. Juni, 2017.
↑ businessinsider.com.pl, abgerufen am 2. Februar 2018.
↑ At a Glance: Global Competitiveness Index 2017–2018 Rankings. In: Global Competitiveness Index 2017–2018. (weforum.org [abgerufen am 6. Dezember 2017]).
↑ reports.weforum.org
↑ heritage.org
↑ Transparency International e. V.: Corruption Perceptions Index 2016. In: www.transparency.org. (transparency.org [abgerufen am 9. Februar 2018]).
↑ Deficyt budżetowy 2017. Ministerstwo Finansów podało wstępne dane. money.pl, 31. Januar 2018, abgerufen am 4. Februar 2018 (polnisch).
↑ Europäische Union: Staatsverschuldung in den Mitgliedsstaaten im 3. Quartal 2017 in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP). Abgerufen am 2. Februar 2018.
↑ abcd CIA World Factbook.
↑ Quelle: GTAI Germany Trade & Invest: Wirtschaftsdaten kompakt – Polen. 26. Juni 2017, abgerufen am 20. September 2017.
↑ ab Website des Staatlichen Statistikamtes – Stopa bezrobocia w latach 1990–2017 (bezrobocie rejestrowane). Abgerufen am 5. November, 2017.
↑ Website des Eurostat – Harmonised unemployment rate by sex Abgerufen am 5. November, 2017.
↑ money.pl
↑ ab Małgorzata Szylko-Skoczny, Ulrich Heiße (Übersetzer): Arbeitsmarktlage und Arbeitsmarktpolitik. In: Dieter Bingen, Krzysztof Ruchniewicz (Hrsg.): Länderbericht Polen. Bonn 2009, ISBN 3-8933-906-0, S. 294–308.
↑ Anna Brzezińska-Rawa, Justyna Goździewicz-Biechońska, Recent developments in the wind energy sector in Poland. Renewable and Sustainable Energy Reviews 38, (2014), 79–87, S. 80, doi:10.1016/j.rser.2014.05.086.
↑ Report on the Polish ower system. Internetseite von Agora Energiewende. Abgerufen am 8. März 2014.
↑ Johanna Herzing: EU-Klimagipfel – Polen schaut mit Sorge nach Brüssel. Deutschlandfunk vom 23. Oktober 2014
↑ contratom.de: Polen verschiebt Atomprogramm. 22. Juni 2013, abgerufen am 8. September 2013.
↑ UNWTO Tourism Highlights, 2013 Edition (PDF; 1,7 MB) im Internet Archive.
↑ UNWTO Tourism Highlights, 2016 Edition | Tourism Market Trends UNWTO In: unwto.org, abgerufen am 19. Februar 2018.
↑ Turyści zagraniczni w Polsce – dane za 2016 r. - Biznes In: onet.pl, abgerufen am 19. Februar 2018.
↑ Warschau für Kinder.
↑ KIELCE ATRAKCJE DLA DZIECI Kadzielnia Muzeum Zabawek świętokrzyskie In: dzieckowpodrozy.pl, abgerufen am 19. Februar 2018.
↑ Gdańsk z dzieckiem 21 atrakcji na weekend z dzieckiem!Przewodnik co zwiedzić In: dzieckowpodrozy.pl, abgerufen am 19. Februar 2018. (Danzig für Kinder; polnisch)
↑ SZCZECIN ATRAKCJE DLA DZIECI aquapark Arkonka opinie In: dzieckowpodrozy.pl, abgerufen am 19. Februar 2018. (Stettin für Kinder, polnisch)
↑ Cittaslow – Homepage In: cittaslowpolska.pl, abgerufen am 19. Februar 2018. (englisch)
↑ Szlak Green Velo In: greenvelo.pl, abgerufen am 19. Februar 2018.
↑ strona wszystkich kajakarzy, kajaki In: kajak.org.pl, abgerufen am 19. Februar 2018.
↑ Główny Urząd Statystyczny: Raport: Transport – Wyniki działalności w 2005 r. 2005, [5].
↑ Podział dróg publicznych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
↑ Reinhold Vetter: Autobahnbau ist Sisyphusarbeit – Polen vor der Fußball-Europameisterschaft 2012. laender-analysen.de, 7. Okt. 2008.
↑ Angaben auf der Seite des polnischen Fremdenverkehrsamtes, abgerufen am 10. Februar 2012.
↑ Märkische Oderzeitung/Frankfurter Stadtbote, 19. August 2005, S. 20.
↑ Czarne punkty. (PDF; 947 kB) Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
↑ PISA-Studie – Organisation for Economic Co-operation and Development. Abgerufen am 14. April 2018 (englisch).
↑ Brigitte Jäger-Dabek: Polen – Eine Nachbarschaftskunde. Bonn 2006, ISBN 3-89331-747-3, S. 69.
↑ Brigitte Jäger-Dabek: Polen – Eine Nachbarschaftskunde. Bonn 2006, ISBN 3-89331-747-3, S. 70–71.
↑ Brigitte Jäger-Dabek: Polen – Eine Nachbarschaftskunde. Bonn 2006, ISBN 3-89331-747-3, S. 81–82.
↑ Andrzej Chwalba: Kurze Geschichte der Dritten Republik Polen 1989 bis 2005. Wiesbaden 2010, S. 121.
↑ Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2012 roku. In: krrit.gov.pl. S. 39, abgerufen am 11. Mai 2013 (PDF; 6,4 MB, polnisch).
↑ Rzeczpospolita 2005, hier nach Andrzej Chwalba: Kurze Geschichte der Dritten Republik Polen 1989 bis 2005. Wiesbaden 2010, S. 123.
↑ Andrzej Chwalba: Kurze Geschichte der Dritten Republik Polen 1989 bis 2005. Wiesbaden 2010, S. 123–124.
↑ Matthias Thiel: Die Laufszene in Polen – Lauf doch mal beim Nachbarn! In: Laufzeit. Juni 2005.
↑ Polnische Laufveranstalter tagten in Jaroslawiec an der Ostsee – Horst Milde und John Kunkeler als Hauptredner. German Road Races, 24. November 2009.
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
52.14694444444419.378055555556Koordinaten: 52° N, 19° O




































































































